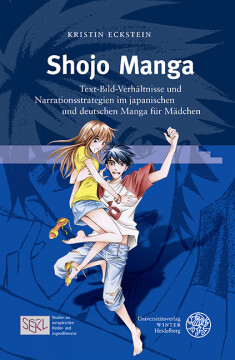
BUCH
Shojo Manga
Text-Bild-Verhältnisse und Narrationsstrategien im japanischen und deutschen Manga für Mädchen
2016
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Manga sind nicht nur in ihrer Heimat Japan, sondern seit einigen Jahren auch in Deutschland nicht mehr wegzudenken und haben sich als fester Bestandteil der Literaturlandschaft etabliert. Damit einhergehend entstand ein neues Genre: Der ,deutsche Manga‘, inspiriert von der Visualität und den Inhalten des japanischen Vorbilds. Der vorliegende Band beschäftigt sich mit den formal-ästhetischen Darstellungskonventionen des japanischen Comics und fokussiert dabei den Shojo Manga, Manga für Mädchen und junge Frauen. Erstmals erfolgt anhand zahlreicher dezidierter Analysen ein direkter Vergleich von japanischem und deutschem Mädchenmanga, der unter Berücksichtigung der Text-Bild-Verhältnisse und narrativen Strategien, aber auch von Aspekten wie Intertextualität, medialer Selbstreferenz und Geschlechterstereotypen die Besonderheiten des sogenannten ,Germanga‘ herausstellt.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Studien zur europäischen Kinder- und Jugendliteratur | 2 | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| 1 Einleitung | 7 | ||
| 2 Kurze Geschichte des japanischen und deutschen Shojo Mangas | 18 | ||
| 2.1 Shojo Manga in Japan: Manga für Mädchen von 1900 bis heute | 18 | ||
| 2.2 Motive des Shojo Mangas | 29 | ||
| 2.3 (Shojo) Manga in Deutschland | 50 | ||
| 3 Text-Bild-Verhältnisse und Erzählstrategien im japanischen und deutschen Shojo Manga | 68 | ||
| 3.1 Visuelle Informationsträger | 71 | ||
| 3.1.1 Panels | 73 | ||
| 3.1.2 Perspektive und Bildeinstellung | 84 | ||
| 3.1.3 Menschliche Figuren | 98 | ||
| 3.1.4 Exkurs: (fe)male gaze, gender bending und Boys Love | 108 | ||
| 3.1.5 Piktogramme | 123 | ||
| 3.1.6 Bildraum | 139 | ||
| 3.1.7 Kolorit | 144 | ||
| 3.2 Verbale Informationsträger | 151 | ||
| 3.2.1 Balloon | 152 | ||
| 3.2.2 Typographie und Lettering | 165 | ||
| 3.2.3 Onomatopoetika | 169 | ||
| 3.2.4 Exkurs: Kommunikation mit den Rezipientinnen | 175 | ||
| 3.3 Text-Bild-Verhältnisse | 182 | ||
| 3.3.1 Induktion | 182 | ||
| 3.3.2 Erzählinstanz und Fokalisierung | 195 | ||
| 3.3.3 Zeit und Raum | 205 | ||
| 3.3.4 Bildlastiges oder textlastiges Erzählen | 216 | ||
| 3.3.5 Exkurs: Intertextualität und mediale Selbstreferenz | 223 | ||
| 4 Zusammenfassung und Ausblick | 229 | ||
| Bildanhang | 238 | ||
| Bibliographie | 261 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 271 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish