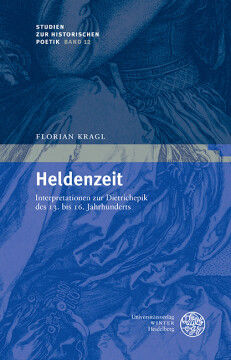
BUCH
Heldenzeit
Interpretationen zur Dietrichepik des 13. bis 16. Jahrhunderts
Studien zur historischen Poetik, Bd. 12
2013
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Gegenstand der Monographie ist die Dietrichepik des hohen und späten Mittelalters und mit ihr der größere Teil der deutschen Heldenepik überhaupt. Es sind dies Texte, um deren narrative und poetische Verfasstheit sich die Forschung lange Zeit nicht oder nur am Rande kümmern wollte. Der vorliegende Band versucht demgegenüber, die Erzählungen von Dietrich von Bern, seinen Kriegen und ›Abenteuern‹ – ‚Dietrichs Flucht‘, ‚Rabenschlacht‘ und ‚Alpharts Tod‘; ‚Goldemar‘, ‚Laurin‘, ‚Sigenot‘, ‚Eckenlied‘, ‚Virginal‘, ‚Rosengarten‘ und ‚Wunderer‘ – dezidiert als literarische Phänomene zu begreifen. Gerahmt von Überlegungen zur mediengeschichtlichen Situierung der Dietrichdichtung im Spannungsfeld von mündlichem Erzählen und schriftlicher Fixierung, ist das Ziel, in Einzelinterpretationen die evidente hermeneutische Resistenz der Dietrichepik präzise zu umreißen, um auf diese Weise die Poetik dieses sprödesten Genres der mittelalterlich-frühneuzeitlichen Erzählliteratur näher zu bestimmen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Vorwort | VII | ||
| Inhaltsverzeichnis | IX | ||
| Ausführliches Inhaltsverzeichnis | 589 | ||
| I. Das Medium der ›Heldenzeit‹ | 1 | ||
| 1. Zitate des Heroischen: Der Marner und Rudolf von Ems | 2 | ||
| 1.1 Der Marner: Heldendichtung und Minnesang | 6 | ||
| 1.2 Rudolf von Ems: Dietrich von Bern gegen Alexander | 10 | ||
| 1.3 Differenz und Kommensurabilität | 18 | ||
| 2. Heroische Überlieferung neben Heldenepik | 20 | ||
| 3. Narratives Gedächtnis | 30 | ||
| 4. ›Heldenzeit‹ | 32 | ||
| 4.1 Mechanische Zeit – erzählte Zeit – Zeitalter | 33 | ||
| 4.2 ›Heldenzeit‹ als Metakategorie | 37 | ||
| 4.3 Ziele | 43 | ||
| 5. Textbasis: ›Dietrichepik‹ | 44 | ||
| DIE DIETRICHEPIK IN INTERPRETATIONEN | 49 | ||
| II. Dietrich weint: ›Dietrichs Flucht‹ und ›Rabenschlacht‹ | 51 | ||
| 1. Gegenseitigkeit | 51 | ||
| 2. Handlungen | 54 | ||
| 2.1 ›Dietrichs Flucht‹ | 54 | ||
| 2.2 ›Rabenschlacht‹ | 58 | ||
| 3. Exkurs: ›Dietrichs Flucht‹ und ›Rabenschlacht‹ | 61 | ||
| 4. Treuemechanik | 65 | ||
| 4.1 Land und Leute | 67 | ||
| 4.2 Bündnispolitik 1: Etzelsöhne | 70 | ||
| 4.3 Bündnispolitik 2: Dietrichs Wert am Hunnenhof | 77 | ||
| 4.4 Ein veritables Vergangenheitslob | 80 | ||
| 4.5 Doppelt funktionale Untreue | 82 | ||
| 4.6 Unendliche Trauer | 86 | ||
| 4.7 Fürstenspiegelungen | 89 | ||
| 5. Poetik des Sagens und Totschlagens | 90 | ||
| 5.1 Kommunikationsmuster | 91 | ||
| 5.2 Kriegsbilder | 94 | ||
| 6. Programmatik: Endlose Doktrin | 101 | ||
| 7. Dreizeitigkeit | 106 | ||
| 8. Warum Dietrich immerzu weint | 115 | ||
| 8.1 Dietwart und Dietrich | 115 | ||
| 8.2 Dietrich und Ermrich | 124 | ||
| 8.3 Die schlechte alte Zeit | 133 | ||
| III. Heimes Treue: ›Alpharts Tod‹ | 137 | ||
| 1. ›Alpharts Tod‹ zwischen ›Dietrichs Flucht‹ und ›Rabenschlacht‹ | 139 | ||
| 2. Alpharts Tod als Skandalon | 141 | ||
| 3. Heimes und Witeges Schuld? | 143 | ||
| 3.1 Feigheit | 143 | ||
| 3.2 Verrat | 148 | ||
| 4. Vom literarischen Mehrwert der Unmöglichkeit, treu zu sein | 153 | ||
| IV. Zeit als Intertext: ›Goldemar‹ | 159 | ||
| 1. Handlung vs. Reflexion | 159 | ||
| 2. Wann spielt der ›Goldemar‹? | 166 | ||
| 3. Parodie und Persiflage | 168 | ||
| V. Zeitvorschriften: ›Laurin‹ | 171 | ||
| 1. ›Laurin‹ A: Agonale Zeit | 171 | ||
| 1.1 Dietrich bî den selben zîten | 171 | ||
| 1.2 Rosengarten: Kompetition | 175 | ||
| 1.3 Berg: Aventiure | 183 | ||
| 1.4 Agon: Dietrich vs. N.N. | 191 | ||
| 2. ›Laurin‹ K, D und Dr: Zeitumstellungen | 195 | ||
| 2.1 ›Walberan‹ (K): it’s a dwarf’s world | 196 | ||
| 2.2 ›Laurin‹ D: Es war einmal ... eine Entführung | 204 | ||
| 2.3 ›Laurin‹ Dr: Archaische Garnitur | 210 | ||
| 2.4 Zeitenzerrung | 215 | ||
| VI. Helden-Haft: ›Sigenot‹ | 219 | ||
| 1. Älterer ›Sigenot‹ | 219 | ||
| 1.1 Prolog vs. Epilog | 219 | ||
| 1.2 Handlung | 222 | ||
| 1.3 Prolog vs. Handlung | 224 | ||
| 1.4 dramatis personae | 226 | ||
| 1.5 Ridikülisierung des Heroischen? | 232 | ||
| 1.6 Zeit – Welt | 236 | ||
| 2. Jüngerer ›Sigenot‹ | 239 | ||
| 2.1 Neuerungen im Handlungsverlauf | 241 | ||
| 2.2 Wieder: dramatis personae | 243 | ||
| 2.3 Explikatives Erzählen | 250 | ||
| 2.4 Urszene des Riesenkampfes | 252 | ||
| VII. Gigantischer Ruhm: ›Eckenlied‹ | 257 | ||
| 1. Problemstellungen | 257 | ||
| 2. Maximen und Reflexionen | 260 | ||
| 2.1 Drei Männer, drei Königinnen und Dietrich | 260 | ||
| 2.2 Ecke versucht sich als Questeheld | 268 | ||
| 2.3 Unerreichbar: Dietrich im Gespräch mit Ecke | 273 | ||
| 2.4 Möge der ... gewinnen | 281 | ||
| 2.5 Haupt-Sache: Dietrich unterwegs nach Jochgrimm | 287 | ||
| 2.6 Problemlösung als Problemtilgung | 295 | ||
| 3. Geschichtsklitterung? | 298 | ||
| 4. Exkurs: Schlussfindungen | 303 | ||
| 4.1 Dresdener ›Eckenlied‹ | 303 | ||
| 4.2 ›Eckenlied‹, Druckversion | 306 | ||
| 5. Fama und Diffamierung | 311 | ||
| VIII. Aventiure historisch: ›Virginal‹ | 323 | ||
| 1. Problemverdoppelung | 323 | ||
| 2. Eckdaten einer Aventiure | 326 | ||
| 3. Pround Contraeiner Aventiure? (ad 1) | 331 | ||
| 3.1 Aventiurebegriffe | 331 | ||
| 3.2 Tapferkeit und Feigheit | 335 | ||
| 4. Ingredienzien einer Aventiure (ad 2) | 347 | ||
| 5. Erzählen einer Aventiure (ad 3) | 355 | ||
| 5.1 Wiederholtes Erzählen | 355 | ||
| 5.2 Wiederholte Aktionen | 361 | ||
| 5.3 Schieflage der Erzählebenen | 363 | ||
| 5.4 Aventiure/Erzählung | 365 | ||
| 6. Aventiure und Historie | 367 | ||
| 7. Exkurs: Wiener und Dresdener ›Virginal‹ | 373 | ||
| IX. Summa heroica: ›Rosengarten‹ | 385 | ||
| 1. Rosengärten – Handlungsübersicht | 385 | ||
| 2. Warum der Rosengarten? | 387 | ||
| 2.1 Boten nach Bern | 388 | ||
| 2.2 Der Rosengarten aus Berner Perspektive | 393 | ||
| 2.3 Konfliktlosigkeit | 396 | ||
| 3. Zwölf Duelle | 399 | ||
| 3.1 Heldenaufstellung | 399 | ||
| 3.2 Kampffolgen | 402 | ||
| 4. Mythos und Heiligkeit | 405 | ||
| 4.1 Held in Mönchskutte | 405 | ||
| 4.2 Dietrichs Feuer | 411 | ||
| 5. Synchronie | 424 | ||
| X. Die Zeit der Allegorie: ›Wunderer‹ | 433 | ||
| 1. Handlungsanalyse | 435 | ||
| 2. Fluchtsage einmal anders: Dietrich, Rüdiger, Etzel | 439 | ||
| 3. Exkurs: ›Dietrichs und Wenezlan‹ | 445 | ||
| 4. Fressen und gefressen werden: Wunderer und Saelde | 450 | ||
| 4.1 Wunderer | 450 | ||
| 4.2 Saelde | 452 | ||
| 4.3 Wunderer vs. Saelde | 456 | ||
| 5. Zwei Erzählebenen | 460 | ||
| 6. Die Wildnis des Abenteuers | 467 | ||
| SCHLUSS | 471 | ||
| XI. Dietrichs Zeit | 473 | ||
| 1. Zyklusbildung | 473 | ||
| 1.1 ›Epochale Zeit‹ | 473 | ||
| 1.2 ›Erzählte Zeit‹ | 476 | ||
| 1.3 Exkurs: ›Historische‹ und ›aventiurehafte‹ Dietrichepik | 479 | ||
| 2. Reflexionsbewegungen | 484 | ||
| 2.1 Historizität und Geschichtlichkeit | 485 | ||
| 2.2 Kämpfertum | 490 | ||
| 3. Diffusion | 495 | ||
| 4. Innovation und Widerständigkeit | 501 | ||
| 4.1 Exkurs: ›Erste‹ und ›zweite Literarisierung‹? | 502 | ||
| 4.2 Handlungskerne und Fassungsunterschiede | 504 | ||
| 4.3 Exkurs: Handlungsschemata | 512 | ||
| 4.4 Zeitblicke und Zeitläufte | 517 | ||
| XII. Szenen des Heroischen | 525 | ||
| ANHANG | 537 | ||
| Inhaltsübersichten | 539 | ||
| Verzeichnisse | 549 | ||
| Abkürzungen | 549 | ||
| Textausgaben | 550 | ||
| Forschungsliteratur | 554 | ||
| Indices und Register | 577 | ||
| Autoren und Werke | 577 | ||
| Zitierte Literatur | 581 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish