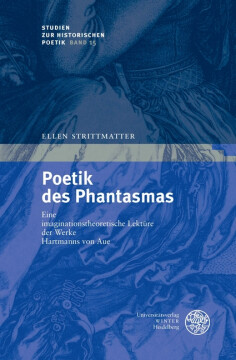
BUCH
Poetik des Phantasmas
Eine imaginationstheoretische Lektüre der Werke Hartmanns von Aue
Studien zur historischen Poetik, Bd. 15
2013
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Erst die Gegenwart eines Vorstellungsbildes stellt mittelalterlicher Wahrnehmungs- und Erkenntnistheorie zufolge die Voraussetzung für das Verstehen dar. Ohne den feinstofflichen Abdruck, der sich im Wahrnehmungsapparat bildet, wenn die äußeren Sinne (sensus exteriores) Informationen an die inneren Sinne (sensus interiores) vermitteln, ist Denken nicht möglich. Wenn Wahrnehmen und Erkennen an die Präsenz eines Phantasmas gebunden sind, wenn der semantische Gehalt der Sprache selbst das Vorhandensein eines Vorstellungsbildes voraussetzt, lässt sich auch das Dichten als Reorganisation der inneren Bilder verstehen, als Produktionsprozess, der die eigenen Bedingungen nachzeichnet und ins Bild setzt. Die vorliegende Studie untersucht am Werk Hartmanns von Aue, wie sich das erkenntnistheoretische Problem der Phantasmen-Bildung in einer Kultur, deren pikturale wie literarische Werke Rücksicht auf die Darstellbarkeit durch Prozesse innerer Verbildlichung nehmen müssen, poetisch umsetzen lässt.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| Einleitung | 11 | ||
| 1. Pneumophantasmologie der Minne | 18 | ||
| 1.1. Minne | 18 | ||
| 1.2. Phantasmologie | 19 | ||
| 1.3. Pneumatologie | 26 | ||
| 2. Eine imaginationstheoretische Lektüre | 32 | ||
| I. Der Arme Heinrich | 41 | ||
| 1. Der Riss an der Oberfläche: Heinrichs Fall | 46 | ||
| 2. Exkurs: Melancholie und "amor hereos" | 56 | ||
| 3. Zwischen Hiob und Absalom: Heinrichs Anamnese | 67 | ||
| 4. Das Wunder zwischen Medizin und Magie | 85 | ||
| 5. Die Möglichkeit des Unmöglichen | 92 | ||
| 6. Zeitliche Unschärfe und Gegenwart | 104 | ||
| 7. Der Spalt in der Wand zur Kammer: Innenblick und Herzensraub | 112 | ||
| 8. Der Schnitt am Herzen des Mädchens: Im Inneren der Kammer | 121 | ||
| 9. Meister und Mädchen: Ratio und Imaginatio | 125 | ||
| 10. Zusammenfassung | 140 | ||
| II. Die Klage | 143 | ||
| 1. Das Minneparadox als Einheit und Spaltung | 146 | ||
| 2. Der ›muot‹ als Materie, Medium und Richtung der Gedankenbewegung | 161 | ||
| 3. Die Minnebiographie | 168 | ||
| 4. Die Wahrnehmung des ›lîp‹: Die inneren Sinne des Herzens | 174 | ||
| 4.1. Sensus interiores | 176 | ||
| 4.2. Ratio | 177 | ||
| 4.3. Memoria | 178 | ||
| 5. Die Wahrnehmung des ›herze‹: Die äußeren Sinne des Leibes | 179 | ||
| 6. Die Gesinnung des Herzens und der Aufruf zur Werbung | 188 | ||
| 7. Das Wenden des ›muotes‹ und der Zauberlist des Herzens | 192 | ||
| 8. Gemeinsamer Minnesang als Neuordnung des sprachlichen Materials | 200 | ||
| 9. Perspektivische Komplexität | 204 | ||
| 10. Zusammenfassung | 206 | ||
| III. Die Artusromane Erec und Iwein | 211 | ||
| 1. Spiegelkalkül und Wiederholung: die Struktur des "Erec"-Romans | 215 | ||
| 2. Wandernde Paare: Distinktion und Äquivalenz der Gleichen | 220 | ||
| 3. Durch den Tod: Erecs und Enites Herzensräume | 226 | ||
| 4. Die Zelterbeschreibung | 228 | ||
| 4.1. Sensus communis (V. 7264–7365) | 234 | ||
| 4.2. Imaginatio (V. 7366–7392) | 244 | ||
| 4.3. Ratio (V. 7462–7525) | 252 | ||
| 4.4. Memoria (V. 7526–7766) | 255 | ||
| 5. Zusammenfassung ("Erec"-Roman) | 265 | ||
| 6. Wiederholung und Inversion: Die Struktur des "Iwein"-Romans | 268 | ||
| 7. Minnemechanismus und Wahrnehmungsapparat: Brunnen-Aventiure und Minneburg | 275 | ||
| 8. Herzensraub und Herzenstausch | 286 | ||
| 9. Bildentzug und Bildwerdung: Iweins Verschwinden und seine Rückkehr als Löwenritter | 291 | ||
| 10. Zusammenfassung (Iwein-Roman) | 305 | ||
| IV. Die Iwein-Fresken auf Burg Rodenegg | 309 | ||
| 1. Verdichtung | 313 | ||
| 2. Dynamisierung | 318 | ||
| 2.1. Szenen I und II | 320 | ||
| 2.2. Szene III | 321 | ||
| 2.3. Szenen IV und V | 323 | ||
| 2.4. Szene VI | 325 | ||
| 2.5. Szenen VII, IX und XI | 327 | ||
| 2.6. Szenen VIII, X und XII | 329 | ||
| 3. Szenenarrangement, Formen, Farben | 331 | ||
| 4. Imaginationsarchitektur | 334 | ||
| V. Die Lieder | 347 | ||
| 1. Die scheinbare Bilderlosigkeit und die Begriffe der Minne | 347 | ||
| 2. Beständigkeit und Wankelmut: Lied I (MF 205,1) | 349 | ||
| 3. Das Maß der Minne: Lied III (MF 207,11) und VIII (MF 212,13) | 361 | ||
| 4. Ferne und Nähe: Lied XVII (MF 218,5) | 368 | ||
| 5. Zusammenfassung | 376 | ||
| Poetik des Phantasmas | 379 | ||
| 1. Die Bilder | 379 | ||
| 2. Der Wahrnehmungsapparat | 379 | ||
| 3. Das Phantasma | 381 | ||
| 4. Typologie des Phantasmas | 383 | ||
| 5. Bilderlosigkeit | 385 | ||
| Literaturverzeichnis | 387 | ||
| Register | 417 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish