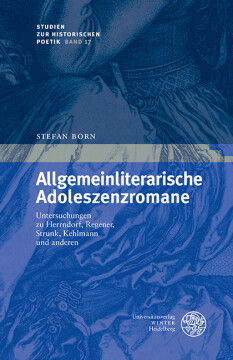
BUCH
Allgemeinliterarische Adoleszenzromane
Untersuchungen zu Herrndorf, Regener, Strunk, Kehlmann und anderen
Studien zur historischen Poetik, Bd. 17
2015
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
In den 90er-Jahren wurde der Adoleszenzroman zu einer nicht nur im jugendliterarischen Bereich erfolgreichen Gattung. Heinz Strunk, Sven Regener und anderen sind vielbeachtete Bestseller in diesem Format gelungen. In der Untersuchung wird analysiert, wieso nach dem »Ende des Erzählens« wieder ein beliebtes Roman-Genre entstehen konnte. Die These der Arbeit ist, dass dieses Genre auf einen in den 90er-Jahren entstandenen Bedarf an moralischer und historischer Orientierung reagiert. Die Romane artikulieren nicht bloß einen Vorschlag, wie persönliche Identitätsbildung während der Adoleszenz gelingen kann, beziehungsweise eine Diagnose darüber, warum sie misslingt. Gleichzeitig entsteht in jedem dieser Romane aus der Adoleszenz-typischen Dialektik zwischen juvenilen und institutionellen Initiativen eine Idee von der spezifischen Historizität der Gesellschaft. So konfiguriert der Adoleszenzroman Vorstellungen darüber, was von der Zeit zu erwarten – und wie sie zu beurteilen ist.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Danksagung | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| 1 Einleitung | 11 | ||
| 1.1 Tendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit den neunziger Jahren | 13 | ||
| 1.2 Gattungen und Genres | 18 | ||
| 1.3 Charakteristika des Adoleszenzromans | 21 | ||
| 1.3.1 Die Adoleszenz und ihre Gesellschaft | 22 | ||
| 1.3.2 Initiationsgeschichte | 29 | ||
| 1.3.3 Bildungsroman | 33 | ||
| 1.3.4 Adoleszenzroman | 44 | ||
| 1.4 Adoleszenzromane seit - 1995 | 62 | ||
| 1.5 Methodische Vorbemerkung | 71 | ||
| 2 Wolfgang Herrndorf | 79 | ||
| 2.1 Zur Person | 79 | ||
| 2.2 In Plüschgewittern (2002) | 81 | ||
| 2.3 Zum Erzähler: Subjektivität als Parodie | 83 | ||
| 2.4 Zwischen Parodie und Gemeinplatz | 96 | ||
| 2.4.1 Topoi der Spießerkritik | 100 | ||
| 2.4.2 Unterstellung der ›magischen Totalität‹ | 107 | ||
| 2.4.3 Topoi der Adoleszenz | 109 | ||
| 2.4.4 Weitere Gemeinplätze der Liebe | 118 | ||
| 2.4.5 Desmond: Konventionen des Dandytums | 122 | ||
| 2.5 Kritik des historischen Diskurses | 128 | ||
| 2.6 Kritik der Popkultur | 129 | ||
| 2.7 Philosophische Grundlegung der autonomen Individualität | 131 | ||
| 2.8 Das letzte Kapitel | 135 | ||
| 2.9 Resümee: Ironisierte heroische Individualität | 137 | ||
| 3 Sven Regener | 141 | ||
| 3.1 Zur Person | 141 | ||
| 3.2 Herr Lehmann (2001) | 144 | ||
| 3.3 Forschungsergebnisse | 145 | ||
| 3.4 Vorüberlegungen zum Stil | 150 | ||
| 3.4.1 Ort und Zeit der Handlung | 152 | ||
| 3.4.2 Der Klang der Worte | 155 | ||
| 3.4.3 Vorbemerkungen zur Hauptfigur | 156 | ||
| 3.5 Beispiele | 159 | ||
| 3.5.1 Das Hund-Prinzip | 160 | ||
| 3.5.2 Zum Zeitgefühl | 163 | ||
| 3.5.3 Staat | 165 | ||
| 3.5.4 Kommerz | 168 | ||
| 3.5.5 Besuch aus der Provinz | 169 | ||
| 3.5.6 Katrin oder die Rationalität des Karrierismus | 171 | ||
| 3.5.7 Karl oder die richtige Initiation ins falsche Leben | 173 | ||
| 3.5.8 Milieus | 175 | ||
| 3.5.9 Mauerfall | 177 | ||
| 3.6 Schlussbemerkungen | 180 | ||
| 4 Heinz Strunk | 183 | ||
| 4.1 Zur Person | 183 | ||
| 4.2 Fleisch ist mein Gemüse (2004) | 186 | ||
| 4.3 Anmerkungen zum Erzähler: Blick des Ressentiments | 190 | ||
| 4.4 Konturen des »großen Gegenentwurfs« | 193 | ||
| 4.4.1 Groteske Psyche, groteske Körper | 194 | ||
| 4.4.2 »Sexuelle Grenzsituationen« | 200 | ||
| 4.4.3 ›Sättigungsgrad‹ der Kultur | 208 | ||
| 4.4.4 Selbstverwirklichung und Arbeit | 215 | ||
| 4.5 ›Stil der Wahrhaftigkeit‹ | 217 | ||
| 4.6 Fleisch ist mein Gemüse: Zusammenfassung | 224 | ||
| 5 Weiterführung der Untersuchung | 227 | ||
| 5.1 Siegfried Lenz: Arnes Nachlaß (1999) | 229 | ||
| 5.1.1 Vorbemerkungen zur Romankonzeption | 230 | ||
| 5.1.2 Der Fallturm oder die Welt | 232 | ||
| 5.1.3 Die ›Herde‹ oder die Ellenbogengesellschaft | 233 | ||
| 5.1.3 Wiebke oder das verirrte Schaf | 235 | ||
| 5.1.5 Kalluk oder die verweigerte Anerkennung | 236 | ||
| 5.1.6 Resümee | 237 | ||
| 5.2 Wilhelm Genazino: Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman (2003) | 240 | ||
| 5.2.1 Zu Ton und Stimmung | 242 | ||
| 5.2.2 Arbeit in der Spedition | 243 | ||
| 5.2.3 Arbeit im Kulturbetrieb | 245 | ||
| 5.2.4 Idee der Geschichtsstille | 247 | ||
| 5.2.5 Resümee | 248 | ||
| 5.3 Daniel Kehlmann: Beerholms Vorstellung (1997) | 252 | ||
| 5.3.1 Überlegungen zu Kehlmanns Konzept des magischen Realismus | 253 | ||
| 5.3.2 Zur Magie in Beerholms Vorstellung | 254 | ||
| 5.3.3 Die Geburt der Manieriertheit aus dem Problem der Kontingenz | 257 | ||
| 5.3.4 Kontingenz versus Ordnung: Der Sieg eines Extrems über das andere | 262 | ||
| 5.3.5 Nimue oder ein rationalistischer Solipsismus | 267 | ||
| 5.3.6 Resümee | 270 | ||
| 5.4 Thomas Glavinic: Wie man leben soll (2004) | 274 | ||
| 5.4.1 Zum Ton | 275 | ||
| 5.4.2 Die Liebe | 277 | ||
| 5.4.3 Politischer common sense | 280 | ||
| 5.4.4 Soziales Umfeld | 281 | ||
| 5.4.5 Mediensatire – Mediengroteske | 283 | ||
| 5.4.6 Resümee | 284 | ||
| 5.5 Fazit zu Kapitel 5 | 287 | ||
| 6 Ergebnisse | 291 | ||
| 6.1 ›Schicksal der Initiative‹ und ›historisches Urteil über die Gesellschaft‹ | 291 | ||
| 6.2 Anwendung der gewonnenen Begriffe auf den Romankorpus | 295 | ||
| 6.3 Genrefunktionen | 306 | ||
| 6.4 Gemeinsame Stilmerkmale | 309 | ||
| 7 Literaturverzeichnis | 315 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish