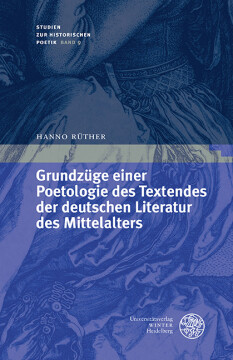
BUCH
Grundzüge einer Poetologie des Textendes der deutschen Literatur des Mittelalters
Studien zur historischen Poetik, Bd. 19
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Ob ein Text als Kunstwerk Geltung beanspruchen kann, zeigt sich nicht zuletzt an der Gestaltung seines Endes. Die Literaturwissenschaft hat sich bislang jedoch kaum systematisch mit dem Textende befasst. Diesem Desiderat entspricht die vorliegende Arbeit in Bezug auf erzählende Texte des deutschen Mittelalters. Methodisch wird dazu jedes Textende als Zusammenspiel von Handlungsende, Textschluss und materiellem Textende beschrieben. Historisch werden etwa 30 Texte aus dem Zeitraum vom 9. bis zum 16. Jahrhundert detailliert untersucht. Dabei erweist sich die althochdeutsche Literatur als strukturell mündlich geprägt und strebt einen quasi formelhaften Schluss an. Je eigene Deutungsabsichten des Stoffes zeigen die Schlussgestaltungen der deutschsprachigen Tristandichtungen. Hartmann von Aue entwickelt in seinen erzählenden Texten eigenständige, von den Vorlagen abweichende Schlusskonzeptionen. Spätmittelalterliche Erzählungen vom Ehebruch versuchen, Anschlusskommunikation zu initiieren und zu steuern.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | iii | ||
| Impressum | iv | ||
| Vorbemerkung | v | ||
| Inhalt | I | ||
| 1. Einleitung | 1 | ||
| 1.1. Literatur und Text | 5 | ||
| 1.2. Literatur und Spiel | 8 | ||
| 1.3. Werk und Fragment | 11 | ||
| 1.4. Die Unverzichtbarkeit des Werkbegriffs | 15 | ||
| 1.5. Skizze des Untersuchungsgangs und Textkorpus | 17 | ||
| 2. Forschungsstand zum Ende literarischer Texte | 21 | ||
| 2.1 Bibliographien und Forschungsberichte | 22 | ||
| 2.2 Die Theorie des Endes literarischer Texte in der Forschung | 29 | ||
| 2.3. Studien zum Ende in mittelalterlichen Texten | 36 | ||
| 2.4. Gattungsübergreifende Studien | 37 | ||
| 2.5. Epische Großformen | 44 | ||
| 2.5.1. Chansons de geste | 49 | ||
| 2.5.2. Heldenepik | 52 | ||
| 2.5.3. Matière de Bretagne | 53 | ||
| 2.6. Epische Kleinformen | 61 | ||
| 2.7. Lyrik | 64 | ||
| 2.8. Gebet und Epilog | 66 | ||
| 2.9. Das Textende in den Poetiken | 71 | ||
| 2.10. Resümee | 76 | ||
| 3. Begriffsklärungen und methodische Überlegungen | 79 | ||
| 3.1. Begriffserklärungen | 79 | ||
| 3.2. Handlungsende | 84 | ||
| 3.2.1. Handlungsende und Erzählstoff | 90 | ||
| 3.2.2. Das Handlungsende in Wolframs ‚Parzival‘ | 93 | ||
| 3.2.3. Handlungsende und Fragment – Wolframs ‚Willehalm‘ | 98 | ||
| 3.3 Textschluss | 104 | ||
| 3.4. Materielles Textende und Schlussformeln | 107 | ||
| 3.5. Resümee | 109 | ||
| 4. Das Textende in der althochdeutschen Literatur | 111 | ||
| 4.1. Mit Schluss überlieferte althochdeutsche Texte | 113 | ||
| 4.1.1 Otfrid von Weißenburg | 114 | ||
| 4.1.2. Der äußere Aufbau des ‚Evangelienbuches‘ | 114 | ||
| 4.1.3. Das Handlungsende des ‚Evangelienbuches‘ | 120 | ||
| 4.1.4. Der Textschluss im ‚Evangelienbuch‘ | 126 | ||
| 4.1.5. Zu den Widmungsschreiben zum ‚Evangelienbuch‘ | 129 | ||
| 4.1.6. Die ‚Gebete Sigiharts‘ | 132 | ||
| 4.1.7. ‚Petruslied‘ | 135 | ||
| 4.1.8. ‚Ludwigslied‘ | 138 | ||
| 4.1.9. ‚Psalm 138‘ | 144 | ||
| 4.1.10. Zwischenfazit | 148 | ||
| 4.2. Texte, deren Vollständigkeit umstritten ist | 149 | ||
| 4.2.1. ‚Wessobrunner Gebet‘ | 149 | ||
| 4.2.2. ‚De Heinrico‘ | 153 | ||
| 4.3. Texte ohne Textende | 158 | ||
| 4.3.1. ‚Christus und die Samariterin‘ | 158 | ||
| 4.3.2. ‚Georgslied‘ | 162 | ||
| 4.3.3. ‚Hildebrandslied‘ | 163 | ||
| 4.3.4. ‚Muspilli‘ | 167 | ||
| 4.4 Resümee zum Textende in althochdeutschen Texten | 168 | ||
| 5. Das Textende der deutschen Tristanromane | 171 | ||
| 5.1. Version commune und version courtoise | 171 | ||
| 5.2. Eilhart von Oberg | 174 | ||
| 5.2.1. Handlungsende und Erzählstoff | 175 | ||
| 5.2.2. Textschluss | 185 | ||
| 5.2.3. Episodische Bauform und Geschlossenheit der Handlung | 186 | ||
| 5.2.4. Varianten der Überlieferung und materielles Textende | 190 | ||
| 5.2.5. Exkurs: Der Schluss bei Thomas von Britannien | 195 | ||
| 5.2.6. Resümee zu Eilharts ‚Tristrant‘ | 199 | ||
| 5.3. Der Prosaroman ‚Tristrant und Isalde‘ | 200 | ||
| 5.3.1. Handlungsende | 201 | ||
| 5.3.2. Textschluss | 202 | ||
| 5.3.3. Abweichungen von Eilhart im Schlussteil | 204 | ||
| 5.3.4. Resümee zum Prosaroman | 206 | ||
| 5.4. Ulrich von Türheim | 207 | ||
| 5.4.1. Handlungsende | 208 | ||
| 5.4.2. Textschluss | 213 | ||
| 5.4.3. Varianten der Überlieferung | 216 | ||
| 5.4.4. Resümee: Ulrichs Text als Fortsetzung | 221 | ||
| 5.5. Heinrich von Freiberg | 223 | ||
| 5.5.1. Handlungsende und Besonderheiten der Handlung | 223 | ||
| 5.5.2. Textschluss und Verhältnis zu Gottfrieds Romanfragment | 227 | ||
| 5.5.3. Geschlossenheit der Handlung und Episodenschlüsse | 229 | ||
| 5.5.4. Resümee zu Heinrichs Tristanfortsetzung | 230 | ||
| 5.6. Resümee zu den Tristanschlüssen | 231 | ||
| 6. Das Textende bei Hartmann von Aue | 235 | ||
| 6.1 Die Klage | 236 | ||
| 6.1.1. Materielles Textende und Handlungsende | 237 | ||
| 6.1.2. Textschluss | 241 | ||
| 6.1.3. Resümee zur ‚Klage‘ | 244 | ||
| 6.2. Der ‚Arme Heinrich‘ | 246 | ||
| 6.2.1. Struktur und Handlungsende | 246 | ||
| 6.2.2. Textschluss | 249 | ||
| 6.2.3. Überlieferungsvariante B | 250 | ||
| 6.2.4. Überlieferungsvariante E | 254 | ||
| 6.2.5. Resümee zum ‚Armen Heinrich‘ | 255 | ||
| 6.3. Gregorius | 257 | ||
| 6.3.1. Handlungsende | 257 | ||
| 6.3.2. Textschluss | 261 | ||
| 6.3.3. Varianten der Überlieferung | 263 | ||
| 6.3.4. Verhältnis zur Vorlage | 264 | ||
| 6.3.5. Exkurs zur Rezeption des ‚Gregorius‘ | 266 | ||
| 6.3.6. Resümee zum ‚Gregorius‘ | 271 | ||
| 6.4. Artusromane | 272 | ||
| 6.5. ‚Erec‘ | 274 | ||
| 6.5.1 Textstruktur und Handlungsende | 274 | ||
| 6.5.2. Textschluss und Verhältnis zu Chrétien | 280 | ||
| 6.5.3. Resümee zu Hartmanns Erec | 285 | ||
| 6.6. Iwein | 287 | ||
| 6.6.1. Handlungsende und Artushof | 288 | ||
| 6.6.2. Textschluss | 292 | ||
| 6.6.3. Vergleich mit Chrétiens ‚Yvain‘ | 295 | ||
| 6.6.4. Textvarianten des ‚Iwein‘ und materielle Textenden | 296 | ||
| 6.6.5. Laudines Kniefall | 300 | ||
| 6.6.6. Resümee zu Hartmann ‚Iwein‘ | 304 | ||
| 6.7. Die Textenden Hartmanns von Aue | 305 | ||
| 7. Das Textenden in schwankhaften Erzählungen vom Ehebruch | 309 | ||
| 7.1. Auswahl der untersuchten Texte | 309 | ||
| 7.2. Forschungsstand zum Textende | 313 | ||
| 7.3. ‚Moralisatio versus narratio‘ | 324 | ||
| 7.4. Textschlusssignale | 326 | ||
| 7.5. Erzählungen vom Ehebruch mit ‚moralisatio‘ | 330 | ||
| 7.5.1. Der Stricker: ‚Der kluge Knecht‘ | 331 | ||
| 7.5.2. Der Stricker: ‚Der begrabene Ehemann‘ | 335 | ||
| 7.5.3. ‚Das Schneekind‘ | 338 | ||
| 7.5.4. Jacob Appet: ‚Der Ritter unter dem Zuber‘ | 343 | ||
| 7.5.5. Heinrich Kaufringer: ‚Der feige Ehemann‘ | 347 | ||
| 7.5.6. Heinrich Kaufringer: ‚Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar‘ | 352 | ||
| 7.5.7. Heinrich Kaufringer: ‚Drei listige Frauen‘ | 358 | ||
| 7.5.8. Resümee zu den Erzählungen mit ‚moralisatio‘ | 362 | ||
| 7.6. Erzählungen ohne ‚moralisatio‘ | 363 | ||
| 7.6.1. Der Stricker: ‚Das heiße Eisen‘ | 364 | ||
| 7.6.2. ‚Der Mönch als Liebesbote (A)‘ | 367 | ||
| 7.6.3. Heinrich Kaufringer: ‚Die Rache des Ehemannes‘ | 371 | ||
| 7.6.4. ‚Die Buhlschaft auf dem Baume‘ | 376 | ||
| 7.6.5. Hans Rosenplüt: ‚Der fahrende Schüler‘ | 382 | ||
| 7.6.6. Resümee zu den Erzählungen ohne ‚moralisatio‘ | 386 | ||
| 7.7. Resümee zu den schwankhaften Erzählungen vom Ehebruch | 387 | ||
| 8. Fazit der Untersuchung | 393 | ||
| 8.1. Zur Poetologie des Textendes | 393 | ||
| 8.2. Ausblick | 403 | ||
| 9. Literaturverzeichnis | 407 | ||
| 9.1. Werke | 407 | ||
| 9.2. Forschung | 411 | ||
| 9.3. Internetquellen | 436 | ||
| 10. Abkürzungsverzeichnis | 438 | ||
| 11. Register der mittelalterlichen Autoren und Werke | 439 | ||
| Backcover | 442 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish