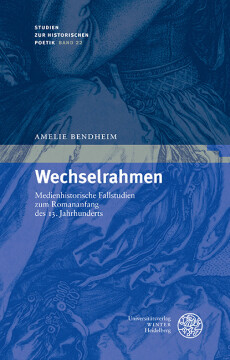
BUCH
Wechselrahmen
Medienhistorische Fallstudien zum Romananfang des 13. Jahrhunderts
Studien zur historischen Poetik, Bd. 22
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die vorliegende Studie unternimmt eine medien- und sozialhistorische Neubeschreibung des Erzählanfangs mittelhochdeutscher Romane, den die Forschung aufgrund seiner scheinbaren Konventionalität bislang oft vernachlässigt hat. Im Kontext der semi-oralen Rezeptions- und Performanzsituation des Mittelalters werden Varianzen in der Überlieferung des Texteingangs nicht als Verderbnis betrachtet, sondern ihnen wird eine kommunikative Funktion zugeschrieben. Anhand detaillierter Einzelanalysen dreier Romane aus dem 13. Jahrhundert (‚Flore und Blanscheflur‘, ‚Wigalois‘, ‚Wigamur‘) wird die erzähltechnische und rezeptionslenkende Funktion des variablen Anfangsrahmens untersucht, die Rückschlüsse auf die (epochenspezifische) Wahrnehmung von Welt erlaubt. Mit dem textanalytischen Modell des ‚Wechselrahmens‘ und der detaillierten Betrachtung paratextueller Elemente eröffnet die Studie neue Perspektiven auf den Erzählanfang als integralen Bestandteil des mittelalterlichen Romans.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 5 | ||
| Vorwort | 11 | ||
| Einleitung: Wohnt jedem Anfang denn ein Zauber inne? | 13 | ||
| I. Textanfang und Rahmen – Theoretische Voraussetzungen, methodische Ansätze | 31 | ||
| 1. Erzählrahmen | 31 | ||
| 1.1 Der Anfang als Teil des Rahmens – Ein bekleideter Text | 31 | ||
| 1.2 Erzählen im Rahmen – Eine funktionale Bestimmung | 34 | ||
| 2. Der Anfang in theoretischer Perspektive – Wie kommt der Text in den Kopf des Rezipienten? | 40 | ||
| 2.1 Rezeptionsästhetik – Input, Interaktion, Imagination | 42 | ||
| 2.2 Phänomenologische Bildtheorie | 54 | ||
| 3. Das Input-Imagination-Modell als Lektüreschlüssel | 73 | ||
| 3.1 Anwendung des Modells – Untersuchungsgegenstand und textfunktionale Werkzeuge | 74 | ||
| 3.2 Paratextualität – Paratextuelle Elemente | 76 | ||
| 3.3 Prologtheorie – Rhetorische Versatzstücke zur Konstruktion des Anfangsrahmens – Von der Bedeutung des Prologs im mittelalterlichen Roman | 84 | ||
| 3.4 Prolog und Rhetorik in der Kontroverse – Zum Status des Prologs für das mittelalterliche Werk | 91 | ||
| 3.5 Narratologische Plotforschung – Der Erzählfaden als Aufbau innerer Handlungsketten | 101 | ||
| 4. Resümee und Vorbedingungen der Textanalyse | 104 | ||
| II. Konrad Flecks ‚Flore und Blanscheflur‘ | 109 | ||
| 1. Erzählen mit Mehrfachrahmung | 109 | ||
| 1.1 Der erste Prolog, ein rhetorisch-didaktischer Anfang | 112 | ||
| 1.2 Paratextuelles Element ›Binnengeschichte‹ – Der Traum von der idealen Erzählsituation | 116 | ||
| 1.3 Prolog zwei und drei – Gesprochene Varianten, gekürzte Sonderformen | 122 | ||
| 1.4 Resümiert – der Anfangsrahmen als Einheit? | 124 | ||
| 2. Die Vorgeschichte als Verbindungsraum zur erzählten Welt – Die pränatale Identität der Helden | 126 | ||
| 2.1 Flores Vorgeschichte – Ein heidnisches Herrscherpaar vor christlicher Folie | 127 | ||
| 2.1.1 Im Fokus: Fenix, Heidenkönig | 129 | ||
| 2.1.2 Parallele im ‚Parzival‘ – Positives Heidenbild in der Vorgeschichte | 139 | ||
| 2.1.3 Resümiert – das veränderte Heidenbild und seine Funktion im Erzählgefüge | 142 | ||
| 2.2 Blanscheflurs Vorgeschichte – Von defizitären Ehepartnern und einer ›falschen‹ Heldenmutter | 145 | ||
| 2.2.1 Blick über den Romanrand – Mesalliancen des Helden in der mittelhochdeutschen Literatur | 146 | ||
| 2.2.2 Literarische Konstruktion und soziale Wirklichkeit | 151 | ||
| 2.2.3 Resümiert – ‚gendertrouble‘ im ‚Flore‘ und Frauen, die aus Erzählungen verschwinden | 155 | ||
| 3. Vom Objekt anderer Figuren zum Subjekt des eigenen Handelns – Identitätskonstruktion des Helden und Idealitätskonzept im Anfang des ‚Flore‘-Romans | 161 | ||
| 3.1 Passive Minneeinheit | 163 | ||
| 3.2 Von der Unmöglichkeit absoluter Minne und – einem Helden ›in der Revolte‹ | 164 | ||
| 3.3 Minne im Baumgarten »Nicht jeder locus amoenus ist ein Paradies« | 169 | ||
| 3.4 Resümiert – der Romananfang als Modellkollision – Konfligierende Identitätsvorstellungen in festem Rahmen | 175 | ||
| 4. Eine lebensweltliche, unheile Welt als Rahmen | 181 | ||
| 4.1 Textrahmenmodell – Historische Versatzstücke als paratextuelle Elemente | 188 | ||
| 5. Kapitelabschluss - Gegensätzliches und Neuartiges im zerdehnten Raum | 189 | ||
| III. Wirnts von Grafenberg ‚Wigalois‘ | 193 | ||
| Vorspann und Hypothese einer semantischen Rahmung | 193 | ||
| 1. Der Prolog um das sprechende Buch »Nur ein gelungener Einfall« oder mehr? | 196 | ||
| 1.1 Das sprechende Buch als paratextuelles Element | 196 | ||
| 1.2 Konstruktion einer zentrierten Erzählwelt | 214 | ||
| 1.3 Resümiert – der Prologdichter als »Sekundärmensch«? | 218 | ||
| 2. Welten, die im Anfang aufgehen - Rezipientenkonditionierung und Rahmengestaltung außerhalb des klassischen Paratextes | 220 | ||
| 2.1 Schauplätze der Vorgeschichte - Artushof und Feenwelt | 222 | ||
| 2.2 Dekonstruktion der arthurischen Coutume | 230 | ||
| 2.3 Potenzierung des Unbekannten - Von fremden Rittern und wunderbaren Gürteln | 235 | ||
| 2.4 Unheile Welten, verschlossene Reiche | 250 | ||
| 2.5 Zwischenfazit – der Gürtel als paratextuelles Element mit Mehrfachsignifikanz | 255 | ||
| 2.6 Räumliche Textklammern und Anfangswelten als Sinnrahmen | 259 | ||
| 3. Aufnahme des Erzählfadens und Ausweis des Heldenmodells | 266 | ||
| 3.1 Vorgeschichtliche Zustände - Wigalois im Objektstatus | 266 | ||
| 3.2 Interaktion im Rahmen der Unmöglichkeit - Wigalois und der Tugendstein | 273 | ||
| 3.3 Subjektivierung des Helden - Selektion durch Separation | 281 | ||
| 3.4 Der Tugendstein als erzähltechnisches Klammerelement | 286 | ||
| 3.5 Aventiurebeispiele – Ruel, Karrioz und Roaz - Wigalois unter göttlichem Schirm | 290 | ||
| 3.6 Resümiert – Erzählen im transzendentalen Sinnrahmen | 297 | ||
| 4. Sinnrahmen im Kontrast - Wirntscher Bildrahmen ‚versus‘ fleckscher Strukturrahmen | 297 | ||
| 4.1 Im ›Spot‹ der Kamera - Filmisches (Kasten-)Verfahren in der Fischerepisode | 301 | ||
| 4.2 Von sehenden Rezipienten und wunderbaren Gegenständen | 304 | ||
| 4.3 Ein Zwischenergebnis – hier ‚(en)wirt‘ mit ‚rede (niht) getân‘ | 306 | ||
| IV. Der anonym überlieferte ‚Wigamur‘ | 315 | ||
| Einführende Überlegungen – ein Textrahmen ohne Prolog | 315 | ||
| 1. Wie der Held stufenweise in die Handlung geschoben wird - Objekt-Subjektverschiebung als Anfangsmarkierung | 318 | ||
| 1.1 Parallele zum ‚Parzival‘ - Zwei tumbe Helden und ihr Wirken im Anfang der Geschichte | 325 | ||
| 1.2 Schritte hin zum Subjekt - Der Held ›lässt die Hüllen fallen‹ | 331 | ||
| 1.3 Aptor und ein Bad in Vorbildlichkeit - Der Tugendstein als Schwellenritus | 333 | ||
| 1.4 Resümiert – ein fertiger Held mit Manko | 335 | ||
| 2. Vorgeschichtliche Welten als Sinnrahmen - Vom Aufbau eines Weltbildes | 338 | ||
| 2.1 Die Unterwasserwelt als vorgeschichtlicher Erzählraum | 338 | ||
| 2.2 Böse Meerfrauen und die Problematik weiblicher Genealogie | 342 | ||
| 2.3 Destruktive Welten | 346 | ||
| 2.3.1 Die Anderwelt als Spiegel der Diesseitswelt | 346 | ||
| 2.3.2 Anderwelt, die Erste Plädoyer gegen eine soziale Utopie | 353 | ||
| 2.3.3 Anderwelt, die Zweite Parkstation Zwergenwelt | 355 | ||
| 2.4 Resümiert – negatives Weltenspektrum und eingeschränkte Utopie | 360 | ||
| 3. Sît ir ritter oder kneht? Wasserwelt und Vaterkampf als rahmende Elemente | 362 | ||
| 3.1 Offene Leerstellen und ein Ritter, der seine Existenz problematisiert | 370 | ||
| 3.2 Zwischenfazit - Modelle der Rahmenkonditionierung im Vergleich | 376 | ||
| 4. Anschlussaventiuren und Rahmung - Der Held als ‚künic‘ | 378 | ||
| 4.1 Der ›zweite‹ Schluss als positiver Kontrastrahmen | 382 | ||
| 5. Kapitelabschluss – der Rahmen formt den Heldenkörper ›The two bodies of Wigamur‹ | 388 | ||
| V. ‚Diz Ist Ein Erste Begin.‘ Elemente und Funktionen der Erzählrahmung im 13. Jahrhundert | 391 | ||
| 1. Die semantische Rahmung – eine bedeutungshaltige Hülle | 392 | ||
| 1.1 Paratextuelle Elemente und Erzählfäden als Analysewerkzeug | 392 | ||
| 1.2 Neue Ansätze für die Untersuchung vormodernen Erzählens | 397 | ||
| 1.3 Inhaltlich-thematischer Bezug zwischen semantischer Rahmung und Haupterzählung | 398 | ||
| 2. Der Wechselrahmen – ein unfestes Gebilde | 402 | ||
| 3. Weitergedacht - Konditionierendes Potenzial und Ablösbarkeit von Nicht-Rahmenelementen | 409 | ||
| 4. Anknüpfung des Erzählfadens und Aufhängung der Erzählung | 412 | ||
| 5. Der große Rahmen - Mythenanaloges Erzählen als Einbettung der Geschichte | 418 | ||
| 6. Fazit – wohnt jedem Anfang ein Zauber inne | 421 | ||
| Anhang | 431 | ||
| 1. Abkürzungsverzeichnis | 431 | ||
| 2. Abbildungsverzeichnis | 432 | ||
| 3. Quellen- und Literaturverzeichnis | 432 | ||
| 1. Quellen | 432 | ||
| 2. Theorie und Forschungsliteratur | 436 | ||
| Backcover | 470 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish