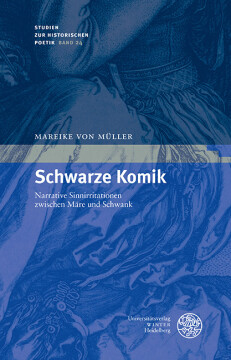
BUCH
Schwarze Komik
Narrative Sinnirritationen zwischen Märe und Schwank
Studien zur historischen Poetik, Bd. 24
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Komik vermag als ästhetisches Phänomen die Sinnstrukturen literarischer Texte herauszufordern und sichtbar zu machen. Besonders deutlich wird dies in der spätmittelalterlichen Literatur, die sich über Gattungsgrenzen hinweg durch differenzierte Sinnspiele auszeichnet und dabei eine spezifische Form des Komischen hervorbringt: Schwarze Komik. Diese Komikform setzt an den axiologisch schwierigen Bereichen des Obszönen, der Gewalt und des Irrationalen an und zielt auf die kalkulierte Verdunkelung von Textsinn. Ein wesentliches Bestreben der Studie ist daher, dem Verhältnis von Narration, Komik und Sinnbildung auf den Grund zu gehen. Dabei zeigt sich, dass die ausgewählten Texte keineswegs von Chaos oder vollständiger Sinnlosigkeit zeugen. Ihre spezifische Pointenstruktur sowie das spannungsvolle Gegeneinander sinnstiftender und sinnirritierender Komponenten reflektieren vielmehr die basalen Voraussetzungen literarischer Sinnerzeugung selbst.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Danksagung | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| 0 Vorbemerkung | 11 | ||
| 1 Einleitung | 13 | ||
| 1.1 Das Ungetüm | 13 | ||
| 1.2 Problemstellung | 22 | ||
| 1.3 Fragestellung | 31 | ||
| 1.4 Methodik und Corpus | 38 | ||
| 2 Begriffe und Techniken des Komischen | 47 | ||
| 2.1 Grundsätzliches und Schwieriges | 47 | ||
| 2.2 (Schwarzer) Humor und Komik | 50 | ||
| 2.3 Das Lächerliche und das Komische | 56 | ||
| 2.4 Kippende Tendenz und Sublimierung | 62 | ||
| 2.5 Anästhetisierung durch repetitive Ästhetisierung | 67 | ||
| 3 Schwarze Komik als Irritation von Sinn | 79 | ||
| 3.1 Dunkelheit, Schwärze und ‚obscuritas‘ | 79 | ||
| 3.2 Ambiguität und Unverständlichkeit | 87 | ||
| 3.3 Literarischer Nonsens und die Motoren der Sinnirritation | 94 | ||
| 3.4 Strukturelle Irritation: Das Ende der Geschichte und die Antipointe | 103 | ||
| 4 Zusammenfassung | 111 | ||
| 5 Schwarze Komik im Märe | 113 | ||
| 5.1 Strategien poetischer Sinnirritation | 113 | ||
| 5.2 Gewalt und Tod in Serie | 117 | ||
| 5.2.1 Kontingenz und Tod | 117 | ||
| 5.2.2 Revidierte Ereignishaftigkeit | 133 | ||
| 5.2.3 Das Ende als Antipointe | 140 | ||
| 5.2.4 Eine Grenzgängerin: ‚Die unschuldige Mörderin‘ | 145 | ||
| 5.3 Diskursive Ratio und Dummheit | 157 | ||
| 5.3.1 Kontingenz und Täuschung | 157 | ||
| 5.3.2 Sprachspiel und schwarze Rhetorik | 170 | ||
| 5.3.3 Revidierte Ereignishaftigkeit | 178 | ||
| 5.3.4 Das Ende als Antipointe | 182 | ||
| 5.4 Verselbstständigte Sexualität und Chaos | 190 | ||
| 5.4.1 Kontingenz und Trieb | 190 | ||
| 5.4.2 Anthropomorphisierung von ‚fut‘ und ‚zagel‘ | 206 | ||
| 5.4.3 Das Ende als Antipointe | 219 | ||
| 6 Schwarze Komik in Rätsel und Spruch | 229 | ||
| 6.1 Dunkelheit und Witz im Kleinstformat | 229 | ||
| 6.2 Kontingenz und Wissen | 236 | ||
| 6.3 Das Unwahrscheinliche und das Unmögliche | 242 | ||
| 6.4 Spielerische Assoziationen | 247 | ||
| 6.5 Anthropomorphisierung und Verselbstständigung von ‚fut‘ und ‚zagel‘ | 251 | ||
| 6.6 Priamel und Antipointe | 255 | ||
| 7 Zwischenfazit | 259 | ||
| 8 Schwarze Komik im Schwankbuch | 261 | ||
| 8.1 Irritationen des satirischen Ernstes | 261 | ||
| 8.2 Die Erzählinstanz und die Vermittlung des Erzählten | 267 | ||
| 8.2.1 Kontingenz und Erzählen | 267 | ||
| 8.2.2 Der Erzählrahmen im ‚Lalebuch‘ | 271 | ||
| 8.2.3 Der Erzählrahmen im ‚Ulenspiegel‘ | 279 | ||
| 8.3 Die Verunsicherungsstrategien der Erzählinstanz | 281 | ||
| 8.3.1 Sinnirritation durch Unzuverlässigkeit | 281 | ||
| 8.3.2 Die Verselbstständigung der Erzählerrede | 288 | ||
| 8.4 Diskursive Ratio und Dummheit | 292 | ||
| 8.4.1 Totale Logik und serielles Scheitern | 292 | ||
| 8.4.2 Totaler Witz und serieller Erfolg | 299 | ||
| 8.5 Das Spiel mit Sprache | 305 | ||
| 8.5.1 Form und Inhalt, Digression und Wiederholung | 305 | ||
| 8.5.2 Skatologische Komik und Sexualkomik | 308 | ||
| 8.5.3 Konkretisierung von Metaphern und Sprichwörtern | 316 | ||
| 8.6 Revidierte Ereignishaftigkeit | 323 | ||
| 8.6.1 Der Tod im ‚Lalebuch‘ | 323 | ||
| 8.6.2 Der Tod im ‚Ulenspiegel‘ | 329 | ||
| 8.7 Das Ende | 335 | ||
| 8.7.1 Von der Pointe zur Antipointe | 335 | ||
| 8.7.2 Der pointenlose Untergang Laleburgs | 340 | ||
| Literaturverzeichnis | 355 | ||
| I Abkürzungsverzeichnis: Reihentitel, Zeitschriften und Lexika | 355 | ||
| II Textausgaben und Primärliteratur | 356 | ||
| III Forschungsliteratur | 358 | ||
| IV Wörterbücher und Internetquellen | 381 | ||
| V Abbildungen | 381 | ||
| Backcover | 382 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish