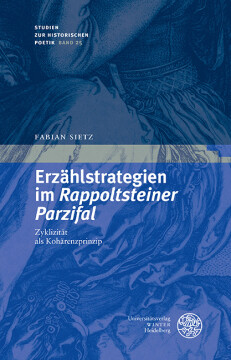
BUCH
Erzählstrategien im ‚Rappoltsteiner Parzifal‘
Zyklizität als Kohärenzprinzip
Studien zur historischen Poetik, Bd. 25
2017
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Der ‚Rappoltsteiner Parzifal‘ kombiniert Wolfram von Eschenbachs ‚Parzival‘ mit aus dem Altfranzösischen übersetzten ‚Fortsetzungen‘ zu Chrétien de Troyes ‚Conte du Graal‘. Kennzeichnend für alle in ihn eingeflossenen Texte ist, dass sie nicht nur von Parzival und seiner Suche nach dem Gral erzählen, sondern auch Geschichten weiterer Artusritter berichten, die nur lose mit der des namengebenden Helden verbunden sind und damit die romanhafte Anlage und den Zusammenhalt des Werks infrage stellen. Die Untersuchung leistet einen Beitrag zur Erforschung dieses bisher wenig beachteten dezentralen Konzepts, indem sie den ‚Rappoltsteiner Parzifal‘ in den Kontext zyklischer Kohärenzstrategien stellt. Unter dieser Perspektive erweist er sich als ein zwar heterogenes, zugleich jedoch auch kohärentes Werk, dessen Zusammenhänge sich erstaunlich oft aus der Kombination der ‚Fortsetzungen‘ mit dem ‚Parzival‘ ergeben. Die Paratexte der Handschriften und das dezentrale Erzählen führen zu einer romanhaft-zyklischen Werkeinheit.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Vorwort | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| 1. Einleitung | 11 | ||
| 1.1. Forschungsstand | 14 | ||
| 1.2. Kohärenzstrategien zyklischen Erzählens | 23 | ||
| 1.2.1. Zyklizität | 25 | ||
| 1.2.2. Produktionstechniken | 27 | ||
| 1.2.3. Einheit | 29 | ||
| 1.2.4. Ordnung | 35 | ||
| 1.2.5. Konnex | 36 | ||
| 2. Codex und Paratext: Einheit und Unterteilung | 43 | ||
| 2.1. Der Codex Donaueschingen 97 | 48 | ||
| 2.1.1. Der Codex als Mittel der Werk-Einheit | 51 | ||
| 2.1.2. Paratext als Innovation | 58 | ||
| 2.1.2.1. Parzival-Überlieferung | 59 | ||
| 2.1.2.2. Conte du Graal-Überlieferung | 62 | ||
| 2.1.3. Narrative Strukturen als Basis paratextueller Gliederung | 68 | ||
| 2.1.3.1. Überschriften | 70 | ||
| 2.1.3.2. Initialen | 89 | ||
| 2.2. Der Codex Bibliotheca Casanatese 1409 | 104 | ||
| 2.2.1. Abschrift und Original | 106 | ||
| 2.2.2. Verbesserung des Paratextes | 112 | ||
| 2.2.2.1. Überschriften | 112 | ||
| 2.2.2.2. Initialen | 114 | ||
| 2.2.2.3. Korrekturmethoden | 119 | ||
| 2.2.3. Kürzende Redaktion | 122 | ||
| 2.2.3.1. Komprimierung und Auslassung | 122 | ||
| 2.2.3.2. Umdichtungen | 131 | ||
| 2.2.3.3. Der Schreiber-Redaktor | 132 | ||
| 2.3. Zwischenfazit | 134 | ||
| 3. Fortführung des Doppelromans | 143 | ||
| 3.1. Programmatik | 147 | ||
| 3.1.1. Der Epilog | 147 | ||
| 3.1.2. Der Prologus | 163 | ||
| 3.1.3. Wolframs Prolog | 173 | ||
| 3.2. Ordnung und Autonomie | 174 | ||
| 3.2.1. Sequentielle Teilerzählungen | 176 | ||
| 3.2.1.1. Karados’ Buch | 176 | ||
| 3.2.1.2. Schwanen-Aventiure | 186 | ||
| 3.2.1.3. Segramors | 193 | ||
| 3.2.2. Parallele Teilerzählungen | 194 | ||
| 3.2.2.1. Bran de Lis und Gingelens | 194 | ||
| 3.2.2.2. Gawan und der erschossene Ritter | 202 | ||
| 3.2.3. Binnenerzählungen | 206 | ||
| 3.3. Zyklische Signale | 213 | ||
| 3.3.1. Übergänge | 214 | ||
| 3.3.2. Epische Schnittstellen | 216 | ||
| 3.3.2.1. Expositionen | 217 | ||
| 3.3.2.2. Synchronisationspunkte | 220 | ||
| 3.4. Alternative Helden | 226 | ||
| 3.4.1. Karados | 230 | ||
| 3.4.2. Gingelens | 242 | ||
| 3.4.3. Gaheries | 247 | ||
| 3.4.4. Segramors | 264 | ||
| 3.4.5. Der Schöne Taugenichts | 275 | ||
| 3.5. Konnex | 279 | ||
| 3.5.1. Heldenentwürfe und mythische Ursprünge | 280 | ||
| 3.5.2. Kausalität und Finalität: Rachefabeln | 287 | ||
| 3.5.3. Exemplarisches Erzählen im minnebuoch | 295 | ||
| 3.6. Zwischenfazit | 306 | ||
| 4. Zusammenfassung und Ausblick | 309 | ||
| 5. Verzeichnisse | 313 | ||
| 5.1. Abbildungen | 314 | ||
| 5.2. Abkürzungen (Zeitschriften, Reihen, Werktitel | 314 | ||
| 5.3. Literatur | 317 | ||
| 5.3.1. Editionen und Übersetzungen | 317 | ||
| 5.3.2. Forschungsliteratur | 318 | ||
| Backcover | 329 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish