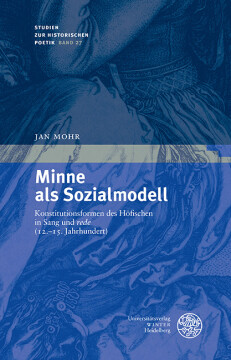
BUCH
Minne als Sozialmodell
Konstitutionsformen des Höfischen in Sang und ‚rede‘ (12.–15. Jahrhundert)
Studien zur historischen Poetik, Bd. 27
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Wie paßt höfische Dichtung die Erfahrungen sozialen Miteinanders in die ihr zur Verfügung stehenden Redeordnungen? Diese Arbeit befragt erstmals ein breites Textcorpus aus Minnesang und ‚erzählenden‘ Minnereden systematisch auf ein implizites Wissen vom Hof als einer sozialen Formation. Sie faßt ‚Minne‘ als semantische Ressource für höfische Selbstauslegung auf und zeichnet an ‚reden‘ und Liedern u.a. Reinmars und Walthers, an Wolframs Tageliedern und Winterliedern Neidharts Möglichkeiten des Minnediskurses nach, soziale Komplexität zu bearbeiten. In dichten Analysen der personalen und institutionalisierten Beziehungsgeflechte, von Raumordnungen, Figurationen des Dritten und von Logiken des Agonalen (Konkurrenz, Aristophilie) erschließen die Untersuchungen Minnesang und Teilbereiche der spätmittelalterlichen Minnerede für wissenssoziologische Perspektiven.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Vorwort | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| 1. Einleitung – der Hof in wissenssoziologischer Perspektive | 11 | ||
| 1.1 Höfische Selbstentwürfe | 11 | ||
| 1.2 Voraussetzungen I: Perspektiven sozialhistorischer Minnesangforschung | 16 | ||
| 1.3 Zum Frageansatz und zur Methodik | 23 | ||
| 1.3.1 Theorie | 27 | ||
| 1.3.1.1 Institutionalität | 27 | ||
| 1.3.1.2 Anregungen der Systemtheorie | 34 | ||
| 1.3.2 Methoden | 37 | ||
| 1.3.2.1 Serielle Analysen – Anregungen der Diskursanalyse | 37 | ||
| 1.3.2.2 Hermeneutische Verfahren: Reihenbildung und ‚close reading‘ | 43 | ||
| 1.3.2.3 Typenbildung | 44 | ||
| 1.3.3 Voraussetzungen II: Sozialstrukturen im Hof-Diskurs des Hohen und späten Mittelalters | 51 | ||
| 1.3.3.1 Gelehrte Diskurse: Utopischer Herrschaftsentwurf, Hofsatire, Ökonomik | 54 | ||
| 1.3.3.2 Laikale Wissensträger: Sinnentwürfe in der Sangspruchdichtung | 57 | ||
| 1.3.4 Analysekategorien | 65 | ||
| 1.3.4.1 Geheimnis und Vertrauen | 68 | ||
| 1.3.4.2 Raumcodierungen | 71 | ||
| 1.3.4.3 Figurationen und Funktionsrollen von Dritten | 75 | ||
| 1.3.4.4 Aristophilie | 80 | ||
| 1.3.4.5 Pragmatisches Paradox: Selbstbeobachtungen von Fremdbeobachtung | 84 | ||
| 1.4 Zum Textcorpus und zum Aufbau der Arbeit | 88 | ||
| 2. Früher Minnesang und Minnekanzone | 91 | ||
| 2.1 Zwei oder Viele? Minnesangs Optionen | 91 | ||
| 2.1.1 Zwei trotz Vieler – Minnedyaden | 93 | ||
| 2.1.2 Zwei unter Vielen – Ritter, Dame, Zinne | 96 | ||
| 2.2 Der Sänger und die vriunde | 105 | ||
| 2.2.1 ‚vriunt‘ – semantische Umrisse | 105 | ||
| 2.2.2 Reziprozität und Selbstbehauptung – Reinmar XVII | 111 | ||
| 2.2.3 Die ‚lôser‘ und die ‚vrowen‘ – Walther Cor 21 | 117 | ||
| 2.3 Figuren des Dritten – Botenlieder | 123 | ||
| 2.3.1 Funktionsbereiche der Botenfigur | 125 | ||
| 2.3.2 Reinmars Botenlieder | 135 | ||
| 2.3.2.1 Ausdifferenzierungen: Reinmar III | 137 | ||
| 2.3.2.2 Informationspolitik: Reinmar XXVII | 144 | ||
| 2.3.2.3 Aufhebung des Botenlieds? Reinmar XXVIII | 150 | ||
| 2.3.2.4 Minne und Vertrauen | 155 | ||
| 2.3.2.5 Kontrolle und Lizenzen der Rede | 160 | ||
| 2.3.2.6 Revocatio oder Redekontrolle | 162 | ||
| 2.4 Resümee: Minneraum, Vertrauensraum, Vortragsraum | 166 | ||
| 3. Wolframs Tagelieder | 175 | ||
| 3.1 ‚Den morgenblic‘ – ein Schlaglicht | 175 | ||
| 3.2 Frühe Formlösungen abseits des Wächterlieds: Aist und Morungen | 184 | ||
| 3.3 Raum- und Zeitsemantiken | 191 | ||
| 3.3.1 Raum- und Zeitkoordinaten in Lied I ‚Den morgenblic‘ | 191 | ||
| 3.3.2 Raum- und Zeitsemantik in Wolframs Liedern II, IV und V | 199 | ||
| 3.4 Das Sozium in Wolframs Tageliedern | 208 | ||
| 3.4.1 Interaktionen und Geheimnisraum | 208 | ||
| 3.4.2 Figuren des Dritten – Wolframs Wächter | 219 | ||
| 3.5 Ereignishaftigkeit und Konventionalität | 226 | ||
| 3.6 Resümee: Ansätze zu einer Institutionalisierung von Lizenzräumen | 238 | ||
| 4. Neidharts Winterlieder | 247 | ||
| 4.1 Sozialsemantik der ‚dörper‘-Welt | 247 | ||
| 4.2 Interaktionsmodi: ‚singen‘ und ‚rûnen‘ | 259 | ||
| 4.2.1 Werbehandeln und Öffentlichkeit | 259 | ||
| 4.2.2 ‚rûnen‘ als Zumutung | 268 | ||
| 4.2.3 Eskalation | 282 | ||
| 4.2.4 Kontrolle und Mäßigung | 287 | ||
| 4.3 Konkurrenz und Aristophilie | 296 | ||
| 4.3.1 Welterschließung | 296 | ||
| 4.3.2 Nähe und Ferne, Zentrum und Peripherie | 306 | ||
| 4.3.3 Werbender und diffamierender Sang | 310 | ||
| 4.4 Resümee: Zerrbild höfischer Sozialität und poetische Freiräume | 316 | ||
| 5. Erzählende Minnereden | 327 | ||
| 5.1 Kommunikationsmodelle, Inklusionslogiken, Raumcodierungen | 327 | ||
| 5.2 Diskurszusammenhänge zwischen Minnesang und Minnereden | 337 | ||
| 5.3 Minne-Reiche: Modelle höfischer Sozia | 361 | ||
| 5.4 Konsoziationsmodelle: Minnegesellschaft und Kloster | 373 | ||
| 5.4.1 Intimer und öffentlicher Zeitvertreib | 373 | ||
| 5.4.2 Minne-Reich und Artushof | 380 | ||
| 5.4.3 Kongregation und Parataxe: das Modell Minnekloster | 388 | ||
| 5.4.4 Welterschließung | 393 | ||
| 5.5 Sujetmuster Minnegericht | 399 | ||
| 5.5.1 Minnemodelle | 399 | ||
| 5.5.2 Labile Instituiertheiten | 414 | ||
| 5.5.2.1 Rechtsprechung, ‚urteil‘ und ‚rât‘ | 418 | ||
| 5.5.2.2 Funktionsrollen und personale Bindungen | 431 | ||
| 5.5.3 Vertrauensbildung und Stigmatisierung | 437 | ||
| 5.6 Resümee: Fremdheitserfahrungen im Minnedispositiv | 450 | ||
| 6. Resümee: Soziale Komplexität als kommunikativer Aufwand | 459 | ||
| 7. Folgerungen und ein Ausblick | 467 | ||
| 7.1 Involviertheit | 467 | ||
| 7.2 Axiologische Stabilität | 472 | ||
| 7.3 Umformung des Diskurses; Negierbarkeitsgewinne | 480 | ||
| 8. Literaturverzeichnis | 483 | ||
| 8.1 Abkürzungen | 483 | ||
| 8.2 Quellen und Textausgaben | 484 | ||
| 8.3 Forschungsbeiträge | 489 | ||
| 9. Register der Personennamen und Texte | 529 | ||
| Backcover | 533 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish