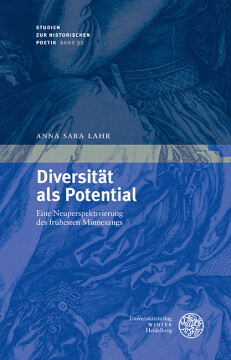
BUCH
Diversität als Potential
Eine Neuperspektivierung des frühesten Minnesangs
Studien zur historischen Poetik, Bd. 32
2020
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Die frühesten Zeugnisse des Minnesangs stehen innerhalb der Minnesang-Philologie seit jeher weniger im Fokus als die Strophen der Hohen Minne und der späteren Phasen; vielmehr gelten jene frühen Lieder, vermutlich entstanden ab der Mitte des 12. Jahrhunderts, eher als eine Art Vorstufe, weniger ausdifferenziert und nuancenreich. Demgegenüber versucht die vorliegende Arbeit, die frühesten Strophen aus der Fluchtlinie des hohen Sangs herauszurücken und sie mittels der bereits verschiedentlich festgestellten ‚Vielfältigkeit‘, ihrer Diversität, beschreibbar zu machen als neuartigen Ausdruck einer personalen, weltlichen Minne, die sich hier in einer neuen Literaturgattung konstituiert und allererst selbst ‚erfindet‘. Dieser Versuch der Neuperspektivierung erfolgt dabei über eine genaue Textanalyse, die sich anhand der Parameter Gender, Emotion, Raum/Zeit/Natur sowie Fiktionalität entfaltet und so einen Vorschlag zu einer differenzierteren Beurteilung der Anfänge des Minnesangs macht.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| 1. Einleitung | 11 | ||
| 1.1. Problemaufriss | 11 | ||
| 1.2. Zugriffsweisen und Methoden | 17 | ||
| 2. Forschungsüberblick | 21 | ||
| 2.1. Herkunftstheorien | 21 | ||
| 2.1.1. ›Einheimische‹ Wurzeln des Minnesangs | 23 | ||
| 2.1.2. Französische Vorbilder | 29 | ||
| 2.1.3. Antike und mittellateinische Einflüsse | 37 | ||
| 2.1.4. Sozial- und mentalitätsgeschichtliche Ansätze | 40 | ||
| 2.1.5. Zwischenfazit und Ausblick | 47 | ||
| 2.2. Weiterführende Ansätze zum frühesten Minnesang | 49 | ||
| 2.2.1. ›Vielfalt‹ als Beschreibungskategorie | 49 | ||
| 2.2.2. Drei Beispiele der Annäherung an den frühesten Minnesang | 53 | ||
| a) Kasten: Frauendienst bei Trobadors und Minnesängern | 53 | ||
| b) Hensel: Vom frühen Minnesang zur Lyrik der Hohen Minne | 57 | ||
| c) Braun: Spiel – Kunst – Autonomie | 60 | ||
| 2.2.3. Abschließende Überlegungen | 63 | ||
| 3. Autoren und Texte der Frühphase | 67 | ||
| 3.1. Eingrenzung des Untersuchungsfeldes | 67 | ||
| 3.2. Die Autoren | 77 | ||
| 3.2.1. Das Autor-Konzept – ein Auslaufmodell? | 77 | ||
| 3.2.2. Biographisches: Auf der Suche nach ›Realitätssplittern‹ | 82 | ||
| a) Der von Kürenberg | 83 | ||
| b) Der Burggraf von Regensburg | 86 | ||
| c) Der Burggraf von Rietenburg | 88 | ||
| d) Meinloh von Sevelingen | 90 | ||
| e) Dietmar von Aist | 91 | ||
| 3.2.3. Zwischenfazit | 93 | ||
| 3.3. ›Literaturhöfe‹ und literarischer Austausch | 94 | ||
| 3.4. ›Donauländischer‹ Minnesang? | 101 | ||
| 3.5. Überlieferungslage | 102 | ||
| 3.5.1. Die Handschriften | 102 | ||
| 3.5.2. Die Texte: Einzel- und Parallelüberlieferung | 108 | ||
| 3.5.3. Zum Umgang mit Zuschreibungsdifferenzen und Textvarianz | 120 | ||
| a) ›Echter‹ oder ›unechter‹ Text? | 120 | ||
| b) Verschiedene ›Fassungen‹ | 124 | ||
| 3.6. Fazit | 128 | ||
| 4. Formale Gestaltung | 133 | ||
| 4.1. Metrisierung und Strophengestaltung – Probleme und Möglichkeiten | 133 | ||
| 4.1.1. Taktzahl und Versfüllung | 137 | ||
| 4.1.2. Kadenzgestaltung | 140 | ||
| 4.1.3. Reim | 145 | ||
| 4.1.4. Strophenform | 148 | ||
| a) Paargereimte Langzeilenstrophen | 150 | ||
| b) Paargereimte Lang- und Kurzzeilenstrophen | 151 | ||
| c) Paargereimte Kurzzeilenstrophen | 153 | ||
| d) Kanzonenstrophen | 154 | ||
| 4.1.5. Satzstrukturen | 158 | ||
| 4.2. Ein- und Mehrstrophigkeit | 159 | ||
| 4.2.1. Wechsel | 160 | ||
| 4.2.2. Liedhafte Einheiten | 165 | ||
| 4.3. Fazit | 174 | ||
| 5. Genderaspekte | 177 | ||
| 5.1. Gender-Theorien und mediävistische Literaturwissenschaft | 177 | ||
| 5.1.1. Theoretische Einführung | 177 | ||
| 5.1.2. Gender-Konstruktionen im frühesten Minnesang | 183 | ||
| 5.2. Rollenverteilung zwischen ›Mann‹ und ›Frau‹ | 190 | ||
| 5.2.1. Sehnsucht, Klage, Leid | 190 | ||
| 5.2.2. Ursachen des Liebesleids | 191 | ||
| 5.2.3. Werbung und Dienst | 202 | ||
| 5.2.4. Lobpreis des Partners | 206 | ||
| 5.2.5. Adressat des Sprechens | 209 | ||
| 5.2.6. Lehrhaftes Sprechen | 211 | ||
| 5.2.7. Aktives und passives Verhalten | 213 | ||
| 5.2.8. Dominanz | 216 | ||
| 5.2.9. Erotisiertes Sprechen | 226 | ||
| 5.2.10. Formale Beobachtungen | 229 | ||
| 5.3. Zwischenfazit: Mannes- und Frauenrede | 232 | ||
| 5.4. Die unmarkierte Sprecherinstanz: ›Androgyne‹ Strophen | 235 | ||
| 5.5. Fazit | 256 | ||
| 6. Emotionen | 259 | ||
| 6.1. Grundlagen der Emotionsforschung | 259 | ||
| 6.1.1. Der Emotionsbegriff | 259 | ||
| 6.1.2. Definition der Emotionen | 261 | ||
| 6.2. Emotionsforschung in mediävistischer Literaturwissenschaft | 264 | ||
| 6.3. Emotionsdarstellung im frühesten Minnesang | 271 | ||
| 6.3.1. Phänomenologie der Emotionen im frühesten Minnesang | 273 | ||
| a) Leid | 273 | ||
| b) Freude (Begierde/Hoffnung) | 279 | ||
| c) Angst | 284 | ||
| d) Zorn/Hass/Eifersucht | 290 | ||
| e) Liebe | 299 | ||
| 6.3.2. Darstellungsweise der Emotionen | 300 | ||
| a) Verbaler Emotionsausdruck | 301 | ||
| b) Körperzeichen | 307 | ||
| c) Szenarien des Emotionsausdrucks | 311 | ||
| d) Didaxe | 314 | ||
| e) symbolische Vermittlung von Emotionen | 317 | ||
| 6.3.3. Emotionsträger | 319 | ||
| 6.3.4. Emotion und Gesellschaft | 322 | ||
| a) Einfluss gesellschaftlicher Kräfte auf das Paargefüge | 322 | ||
| b) Wirkung auf die Gesellschaft | 327 | ||
| 6.4. Fazit | 328 | ||
| 7. Raum, Zeit und Natur | 333 | ||
| 7.1. Raum(-Zeit-)Forschung und ihr Bezug zur Mediävistik | 333 | ||
| 7.2. Raumdarstellung im frühesten Minnesang | 339 | ||
| 7.2.1. Vorannahmen | 339 | ||
| 7.2.2. Der Raum sozialer Kontakte | 341 | ||
| a) Konkrete Räumlichkeit | 341 | ||
| b) Konnotative Ortsevokationen | 343 | ||
| c) Dynamische Räumlichkeit | 344 | ||
| d) Metaphorische Räumlichkeit | 346 | ||
| e) Ergebnis | 348 | ||
| 7.2.3. Naturräume | 349 | ||
| a) Natur im Minnesang | 349 | ||
| b) Naturräume im frühesten Minnesang | 352 | ||
| c) Ergebnis | 359 | ||
| 7.3. Zeitliche Darstellung im frühesten Minnesang | 360 | ||
| 7.3.1. Vorannahmen | 360 | ||
| 7.3.2. Natur-Zeit | 365 | ||
| a) Jahreszeiten | 366 | ||
| b) Tageszeiten | 379 | ||
| c) Ergebnis | 380 | ||
| 7.4. Fazit | 382 | ||
| 8. Fiktionalität | 385 | ||
| 8.1. Grundlagen | 385 | ||
| 8.2. Institutionalisierungsgrade der Fiktionalität im frühesten Minnesang | 396 | ||
| 8.2.1. Sanglicher Vortrag und poetische Sprache | 396 | ||
| 8.2.2. Rollenhaftigkeit | 398 | ||
| a) Räsonierend-berichtendes Sprechen | 399 | ||
| b) Das Gegenüber und sein fiktionaler Status | 401 | ||
| c) Einbeziehung des Publikums | 406 | ||
| d) Das Boten-Ich | 411 | ||
| e) Das Erzähler-Ich | 413 | ||
| f) Inszenierung des Sänger-Ichs | 415 | ||
| 8.3. Fazit | 423 | ||
| 9. Resümee | 427 | ||
| 10. Anhang | 431 | ||
| 11. Literaturverzeichnis | 435 | ||
| 11.1. Abgekürzt zitierte Literatur | 435 | ||
| 11.2. Textausgaben | 436 | ||
| a) Minnesang- Ausgaben (nach Erscheinungsjahr) | 436 | ||
| b) Weitere Textausgaben und Hilfsmittel | 437 | ||
| 11.3. Sekundärliteratur | 437 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish