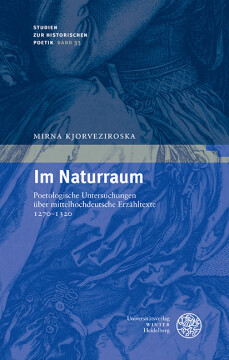
BUCH
Im Naturraum
Poetologische Untersuchungen über mittelhochdeutsche Erzähltexte 1270–1320
Studien zur historischen Poetik, Bd. 33
2022
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Erzählte Zelte, Bäume als Räume, bewohnbare Tierkörper, höllische Höhlen und Grotten stehen im Mittelpunkt der vorliegenden Studie, die Fragen der Raumforschung mit einem ideengeschichtlichen Interesse am Naturbegriff zusammenführt. Gegenstand der Interpretation sind Unterkünfte im Naturraum, die eine Figur schafft, wählt oder annehmen muss, um größere oder kleinere zeitliche Intervalle fern von der Burg zu überbrücken. Die räumlichen Modalitäten des Aufenthaltes in einer natürlichen Umgebung werden als Kristallisationspunkte des gedachten und gedichteten Verhältnisses des Menschen zur Natur außerhalb seiner selbst und zugleich zur menschengeschaffenen höfischen Kultur gelesen. In elf Raumgeschichten, die ein breites Spektrum von mittelhochdeutschen Erzähltexten um 1300 abschreiten, werden die diskursiven Kodierungen und narrativen Umsetzungen dieser so spannenden wie spannungsreichen Begegnung zwischen Mensch und Natur untersucht.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Vorwort | 7 | ||
| Inhalt | 9 | ||
| 1 Einleitung: ‚Ubi sunt?‘ | 11 | ||
| 2 Artifizielle Unterkünfte: Zelte | 47 | ||
| 2.1 Darius’ Zelt in Ulrichs von Etzenbach ‚Alexander‘ | 53 | ||
| 2.1.1 Angenommene Raumalternativen | 53 | ||
| 2.1.2 Das Zelt als höfische Exklave | 59 | ||
| 2.2 Das Zelt der Natura in Heinrichs von Neustadt ‚Gottes Zukunft‘ | 72 | ||
| 2.2.1 Die Epiphanie der Natura | 72 | ||
| 2.2.2 Die Adresse der Personifikationen | 78 | ||
| 2.2.3 Dreieinhalb Begründungsversuche des Zeltes | 98 | ||
| 2.3 Der Spalt in der Zeltwand in der Minnerede ‚Minne und Gesellschaft‘ (B480) | 104 | ||
| 2.3.1 Raumregie des Lauschens | 104 | ||
| 2.3.2 Der naturvergessene Held | 120 | ||
| 2.4 Agrants Himmelszelt in Johanns von Würzburg ‚Wilhelm von Österreich‘ | 135 | ||
| 2.4.1 Naturnachbildung und Himmel im Plural | 135 | ||
| 2.4.2 Alternative Raumverschaltungen: Allegorische und durchsichtige Räume | 156 | ||
| 2.5 Zusammenfassung | 166 | ||
| 3 Natürliche Unterkünfte | 171 | ||
| 3.1 Organische Unterkünfte | 171 | ||
| 3.1.1 Vegetabile Aufenthaltsorte: Bäume als Räume | 171 | ||
| 3.1.1.1 In dem Baum – Die Baumhöhle in Konrads von Würzburg ‚Partonopier und Meliur‘ | 175 | ||
| 3.1.1.1.1 Erzauberte, imaginativ ergänzte und emotional aufgeladene Naturräume im ›psychologischen‹ Roman | 175 | ||
| 3.1.1.1.2 Ein hohler Baumstamm für den moralisch ausgehöhlten Ritter: Idoneität zwischen Mensch und Naturraum | 197 | ||
| 3.1.1.1.3 Partonopier als Baumeremit | 203 | ||
| 3.1.1.1.4 Die Baumhöhle als vegetabiler Uterus: Partonopiers Wiedergeburt | 217 | ||
| 3.1.1.1.5 Die Baumhöhlenepisode als mythische Appendix | 230 | ||
| 3.1.1.2 Unter dem Baum: Ein Apfelbaum und ein Pfirsichbaum in Konrads von Würzburg ‚Partonopier und Meliur‘ | 254 | ||
| 3.1.1.2.1 Der Baum als topologisches Homonym: Waldbäume und Gartenbäume | 254 | ||
| 3.1.1.2.2 Metonymie, metonymisches Erzählen und Raummetonymien | 261 | ||
| 3.1.1.2.3 Konversationsregeln unter dem Baum: Inhaltsrelevanz und Themenzentriertheit | 273 | ||
| 3.1.1.3 Auf dem Baum: Der bestiegene Baum im ‚Bûsant‘ und in Veit Warbecks ‚Die schöne Magelone‘ | 294 | ||
| 3.1.1.3.1 Wiedergänger in der deutschen Literaturgeschichte | 294 | ||
| 3.1.1.3.2 Die Baumbesteigung zwischen dem hellenistischen Liebes- und Reiseroman und dem mittelhochdeutschen Minne- und Abenteuerroman | 314 | ||
| 3.1.1.3.3 Epistemik und Ethik der Vertikalität | 326 | ||
| 3.1.1.3.4 Intertextualität durch Räume: Magelone und Sigune | 350 | ||
| 3.1.1.4 Zusammenfassung | 359 | ||
| 3.1.2 Animale Aufenthaltsorte: Tierkörper als bewohnbarer Körper-Raum | 363 | ||
| 3.1.2.1 Der bewaldete Wal in Johanns von Würzburg ‚Wilhelm von Österreich‘ | 369 | ||
| 3.1.2.1.1 Auf dem Wal zur Erwählten | 369 | ||
| 3.1.2.1.2 Motivgeschichtliche Wal(l)fahrten | 376 | ||
| 3.1.2.1.3 Aktive Räume und passive Helden | 387 | ||
| 3.1.2.2 Das Schneckenhaus in Heinrichs von Neustadt ‚Apollonius von Tyrland‘ | 399 | ||
| 3.1.2.2.1 Die Topographie einer Intrige | 399 | ||
| 3.1.2.2.2 Vom enzyklopädischen Raum zur erzählten Unterkunft | 406 | ||
| 3.1.2.2.3 Elliptische Räume | 422 | ||
| 3.1.2.3 Zusammenfassung | 437 | ||
| 3.2 Anorganische Unterkünfte: Höhlen und Grotten | 441 | ||
| 3.2.1 Peluas und Garganas Höhlen in Heinrichs von Neustadt ‚Apollonius von Tyrland‘ | 445 | ||
| 3.2.1.1 Eine Zwiebelschalenaventiure | 445 | ||
| 3.2.1.2 Die Höhle als phänomenaler Nullpunkt | 463 | ||
| 3.2.1.3 Nächte aus Kalzit: Höhle und ‚slâf‘ | 468 | ||
| 3.2.2 Savilons Grotte auf dem Magnetberg im ‚Reinfried von Braunschweig‘ | 476 | ||
| 3.2.2.1 Grotten-Neugier | 476 | ||
| 3.2.2.2 Die Grotte als Vergangenheitskonserve | 503 | ||
| 3.2.3 Zusammenfassung | 523 | ||
| 4 Schlussbemerkungen und Ausblick: ‚Wâ und wâ / Anderswâ‘ | 525 | ||
| Literaturverzeichnis | 539 | ||
| Autoren- und Werkregister | 641 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish