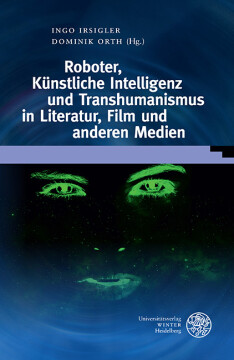
BUCH
Roboter, Künstliche Intelligenz und Transhumanismus in Literatur, Film und anderen Medien
Herausgeber: Irsigler, Ingo | Orth, Dominik
Wissenschaft und Kunst, Bd. 36
2021
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Mediennarrative haben einen entscheidenden Anteil an der Virulenz von Robotern, Künstlicher Intelligenz und Transhumanismus als Gegenstand soziokultureller Debatten. Dabei spielen auch fiktionale Erzählungen eine zentrale Rolle – in der Literatur, im Film oder im Computerspiel. Ähnliche Diskurse lassen sich zudem in den Bildenden Künsten, im Theater, in der Popmusik oder in dokumentarischen Formen feststellen. Gemeinsam ist all diesen medialen Formaten, dass die Thematisierung von Robotern, Künstlicher Intelligenz und Transhumanismus eine gesellschaftliche Wirkung entfaltet: Es handelt sich um Technikreflexionen, die die Optimierung der Welt und des Menschen thematisieren und somit die Rezipient*innen mit anthropologischen, ethischen und moralischen Grundfragen konfrontieren. Der Band analysiert und interpretiert historische und zeitgenössische mediale Auseinandersetzungen mit den genannten Technologien. Dabei geht es insbesondere um die Frage, welchen Beitrag kulturelle Artefakte zu Technikdiskursen leisten.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 5 | ||
| Ingo Irsigler und Dominik Orth - Von Maschinen und Menschen. Technik-Fiktionen als Selbstreflexionen des Homo sapiens | 9 | ||
| I Literatur | 25 | ||
| Stephan Brössel - Die Anthropologie der Goethezeit und ‚Automaten‘: Ein diskursanalytischer Aufriss und eine exemplarische Analyse von E. T. A. Hoffmanns ‚Die Automate‘ (1814) | 27 | ||
| Manuel Mackasare - Prognosen zur Robotik. Zukunftswissen in Ernst Jüngers Roman ‚Gläserne Bienen‘ | 45 | ||
| Hans-Edwin Friedrich - „ENIAC tritt aus dem Dunkel.“ Megacomputer in der deutschen Science-Fiction der 1950er bis 1970er Jahre | 63 | ||
| Ingo Irsigler - Ästhetische Selbstreflexionen. Künstliche Intelligenz und Transhumanismus in deutschsprachigen Gegenwartsromanen | 107 | ||
| II Film | 125 | ||
| Eckhard Pabst - Ein Mensch ist eine Maschine ist ein Mensch. Gleichheit und Differenz in Fritz Langs ‚Metropolis‘ | 127 | ||
| Jennifer S. Henke - Das Stepford-Syndrom: Zur fiktionalen Verhandlung der Sexrobotik | 141 | ||
| Ines Lenkersdorf - Pandora Ex Machina. Schöpfungsmythen und ihre Varianz in ‚Ex Machina‘ | 159 | ||
| Heinz-Peter Preußer - Der traurige ‚Chic‘ des Vollkommenen – Selbstoptimierte Menschen und perfekte Androiden | 175 | ||
| Regine Zeller - Super-Humanismus. Mensch-Maschine-Hybride und die Restitution des rationalen Subjekts im Superhelden-Blockbuster | 189 | ||
| Oliver Schmidt - Robo Culturalis. Roboter und KI als kulturelle Akteure in Film und Gesellschaft | 207 | ||
| III Transmedial und andere Medien | 225 | ||
| Maren Conrad - Maschinenfrauen. Eine kurze Genealogie künstlicher Weiblichkeit zwischen Humanismus und Transhumanismus | 227 | ||
| Felix Schniz - Die Schöpfung der Androiden. Von Mensch-Maschinen und Maschinengöttern in Ridley Scotts ‚Alien‘-Universum | 249 | ||
| Rebecca Haar - Wovon träumen Androiden? Oder: Der Wunsch nach Menschlichkeit im Artifiziellen in ‚Star Trek – The Next Generation‘ | 263 | ||
| Christoph Rauen - Tanz in den Paraspace. Techniken der Selbsttranszendierung in Jeremy Shaws Science-Fiction-Mockumentarys ‚Quickeners‘, ‚Liminals‘ und ‚I Can See Forever‘ (Video-Installationen, 2014–2018) | 279 | ||
| Sabine Coelsch-Foisner - ‚Robo Theatralis‘, Transhumanes Theater und ‚Metal Opera‘: Theater als Vorbild und Widerstand gegen transhumanes Anderswerden (mit Beispielen aktueller Produktionen: ‚OEdipe‘, ‚T.H.A.M.O.S‘, ‚Solaris‘, ‚Golem‘ und ‚Hoffmanns Erzählungen‘) | 291 | ||
| Über die Autor*innen | 313 | ||
| Abbildungsnachweise | 317 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish