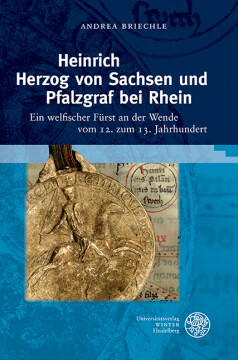
BUCH
Heinrich Herzog von Sachsen und Pfalzgraf bei Rhein
Ein welfischer Fürst an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert
Heidelberger Veröffentlichungen zur Landesgeschichte und Landeskunde, Bd. 16
2013
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Als Heinrich dem Löwen 1180 die Reichslehen entzogen wurden, bedeutete dies eine Zäsur, deren Folgen das Reich noch für Jahrzehnte beschäftigen sollten. Unmittelbar betroffen waren die welfischen Söhne, die ihre Handlungsspielräume im Ordnungsgefüge von Königen und Fürsten, Herzogtümern und Herrschaften an der Wende des 12. zum 13. Jahrhundert aus alten Traditionen und neuen Möglichkeiten entwickelten. Die vorliegende Studie widmet sich der Biographie des ältesten Sohnes des Löwen im Rahmen der verwandtschaftlichen Bindungen der Welfen sowie der Bilder und Inszenierungen fürstlichen Handelns. Durch diesen Heinrich (†1227) wurden mit dem alten Herzogtum Sachsen und der Pfalzgrafschaft bei Rhein zwei Regionen mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen zusammengefasst. Heinrichs Urkunden geben Aufschluss darüber, wie fürstliche Integrationskraft Würden und Güter zusammenband, bevor das Territorium zum Bezugspunkt politischer Ordnung wurde.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 5 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| 1 Einleitung | 11 | ||
| 2 Verwandtschaft als Ordnungskategorie | 19 | ||
| 2.1 Familie und Verwandtschaft: Die Verortung Heinrichs | 19 | ||
| 2.2 Sohn Heinrichs des Löwen und Mathildes von England | 26 | ||
| 2.2.1 Zwischen Sachsen und England | 26 | ||
| 2.2.2 Vater und Sohn | 32 | ||
| 2.2.3 Dynastische Memorialleistungen: Heinrich der Löwe und Mathilde in den Urkunden des Sohnes | 40 | ||
| 2.3 Heinrich als Ehemann zweier Agnes | 45 | ||
| 2.3.1 Agnes von Staufen: geschickter Coup oder Romanze? | 45 | ||
| 2.3.2 Agnes von Landsberg: neue verwandtschaftliche Perspektiven | 68 | ||
| 2.3.2.1 Agnes als Gründerin von Wienhausen und Isenhagen | 73 | ||
| 2.4 Königsbruder | 79 | ||
| 2.4.1 Zwischen "potior pars consilii regis" und Königsverlassung (1198–1204) | 79 | ||
| 2.4.2 Auf Seiten Philipps von Schwaben (1204–1208) | 102 | ||
| 2.4.3 Beförderer des brüderlichen Kaisertums (1208–1214) | 111 | ||
| 2.4.4 Die Kämpfe im Norden (1214–1218) | 120 | ||
| 2.4.5 Das Testament Ottos IV. | 121 | ||
| 2.5 Heinrich als Onkel des ersten Herzogs von Braunschweig(-Lüneburg) | 124 | ||
| 2.5.1 Der Neffe und das Erbe | 124 | ||
| 2.5.2 Schwiegervater von Wittelsbach und Baden: die Ehen der Töchter | 128 | ||
| 3 Bilder und Inszenierungen fürstlichen Ranges | 137 | ||
| 3.1 Rang und Titel: Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Sachsen | 137 | ||
| 3.1.1 Der Pfalzgraf und die Königswahl | 137 | ||
| 3.1.2 Titulaturen, Siegel, Ämter | 147 | ||
| 3.2 Fürstenbilder | 167 | ||
| 3.2.1 Der Held der Belagerung Burg Torons | 167 | ||
| 3.2.2 Ein Förderer volkssprachlicher Literatur? | 172 | ||
| 3.2.2.1 Der „Lucidarius“ und Eilharts „Tristrant“: zwischen Wissensver-mittlung und Liebesthematik | 172 | ||
| 3.2.2.2 Bligger von Steinach: ein dichtender Gefolgsmann? | 180 | ||
| 3.2.3 Der „Ernestus“ des Odo von Magdeburg: Höllenstrafen für den Pfalz-grafen | 183 | ||
| 3.2.4 Der Stifter im Bild? | 187 | ||
| 4 Herrschaft in der Pfalzgrafschaft bei Rhein und im welfischen Sachsen | 191 | ||
| 4.1 Die Pfalzgrafschaft bei Rhein | 191 | ||
| 4.1.1 Pfalzgräfliche Gefolgschaften | 191 | ||
| 4.1.2 DieTrierer Vogtei | 197 | ||
| 4.1.3 Das Zisterzienserkloster Schönau: Grablege der Pfalzgrafen | 200 | ||
| 4.1.4 Der Pfalzgraf und die Zisterziense | 218 | ||
| 4.2 Die welfischen Besitzungen in Sachsen | 223 | ||
| 4.2.1 Das Herzogtum Sachsen: Durchsetzung welfischer Ansprüche | 223 | ||
| 4.2.2 Bischöfe und Kirchenlehen | 232 | ||
| 4.2.3 Heinrichs Urkunden für die geistlichen Gemeinschaften in Braunschweig | 247 | ||
| 4.2.3.1 St. Blasius | 248 | ||
| 4.2.3.2 St. Cyriacus | 256 | ||
| 4.2.3.3 St. Aegidien | 257 | ||
| 4.2.4 Heinrichs Urkunden für die Zisterzienserklöster Riddagshausen und Mariental | 259 | ||
| 4.2.4.1 Riddagshausen | 259 | ||
| 4.2.4.2 Mariental | 261 | ||
| 4.2.5 Homburg | 266 | ||
| 4.2.6 Osterholz | 268 | ||
| 4.2.7 Loccum | 271 | ||
| 4.2.8 Einbeck | 272 | ||
| 4.2.9 Der Deutsche Orden | 275 | ||
| 5 Abgesang | 277 | ||
| Abbildungen | 283 | ||
| Quellen- und Literaturverzeichnis | 295 | ||
| Archivalische Quellen | 295 | ||
| Gedruckte Quellen und Regestenwerke | 297 | ||
| Literatur | 309 | ||
| Register | 335 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish