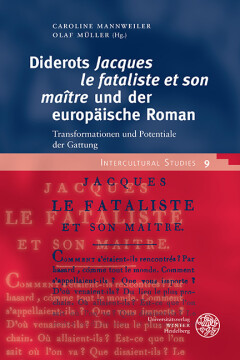
BUCH
Diderots ‚Jacques le fataliste et son maître‘ und der europäische Roman
Transformationen und Potentiale der Gattung
Herausgeber: Mannweiler, Caroline | Müller, Olaf
Intercultural Studies, Bd. 9
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Zu den bis heute weltweit einflussreichsten Romanen des 18. Jahrhunderts gehört Denis Diderots ‚Jacques le fataliste et son maître‘, den der Autor zu Lebzeiten nur einem exklusiven Leserkreis vorbehielt und der erst nach seinem Tod in Buchform erschien. Der Roman, selbst schon eine Reaktion auf und praktische Reflexion über diverse Spielarten der Romangattung von der Antike bis in seine damalige Gegenwart, erfährt von Schiller und Goethe über Puškin, Machado de Assis und Brecht zu Kundera, Henri Lopes, Cécile Avouac oder Sophie Divry bis in die heutige Gegenwartsliteratur immer wieder produktive Fortschreibungen. Wie die vielen Binnenerzählungen in ‚Jacques le fataliste et son maître‘ beweisen, war Diderot durchaus in der Lage, Geschichten zu erzählen. Begnügen wollte er sich damit jedoch nicht. Stattdessen liefert sein Roman einen Reichtum an Auseinandersetzungen mit dem Produktions- und Rezeptionsprozess von Romanen, der im vorliegenden Band in historisch überzeugenden Einzelstudien an Beispielen der europäischen und lateinamerikanischen Literatur detailliert exponiert wird. Wertvoll war und ist Diderots Roman besonders für Autor*innen, die in romantheoretischen Überlegungen kein leeres Spiel, sondern ein Fundament des Romanschreibens erkennen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Einleitung | 7 | ||
| Jacques le fataliste, der Antiroman, dessen Held Du bist: Colas Duflo | 17 | ||
| Diderots Jacques le fataliste und die Potentialisierung pikaresken Erzählens aus zweiter Hand: Frank Estelmann | 29 | ||
| Drei Variationen über die Freiheit des Erzählens (Sterne – Diderot – Gritti): Robert Fajen | 45 | ||
| Merkwürdiges Beispiel einer Textverschlingung. Libertinage als Erzählstrategie in Diderots „Jacques le fataliste“. Mit einem Umweg über Crébillons „Sopha“ und Diderots Übersetzer: Henning Hufnagel | 59 | ||
| Vom narrativen Rätsel zur rätselhaften Psyche. Exemplarisches Erzählen bei Diderot und in Schillers „Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache“: Christine Waldschmidt | 79 | ||
| „nur eine – Arabeske“? Diderots „Jacques le fataliste“ im Kontext der Romantheorie Friedrich Schlegels: Caroline Mannweiler | 95 | ||
| „Le Fils naturel“ und „Jacques le fataliste“. Diderots Experimente auf der Gattungsgrenze und ihr Echo im Lesedrama des frühen 19. Jahrhunderts: Charlotte Krauss | 113 | ||
| Metafiktionalität und Bedeutungsgenese: Kommunikationstheoretische Anmerkungen zu Diderot, Puškin und Slowacki: Alfred Gall | 127 | ||
| ‚Es gibt Dinge, die man am besten sagt, indem man von ihnen schweigt‘. Herausforderungen des Lesers in „Dom Casmurro“ von Joaquim Maria Machado de Assis: Hans Paschen | 145 | ||
| Inspiration – Transformation – Interpretation. Zur dreifachen Bedeutung von Diderots „Jacques le fataliste“ für Brechts „Flüchtlingsgespräche“: Frank Zipfel | 161 | ||
| „Ceci n’est point un roman“ oder das Spiel mit den Gattungsgrenzen in Milan Kunderas Drama „Jakub a jeho pán“ (nebst einer Typologie der drei Grundgattungen): Andreas Ohme | 181 | ||
| Im Schatten Diderots. Hans Magnus Enzensbergers Radio-Roman „Jakob und sein Herr“ (1979): Nikolas Immer | 201 | ||
| Jacques und Corporal Trim im Text-Duell. Zur Intertextualitätspoetik in einer Novelle Cécile Avouacs: Tobias Berneiser | 215 | ||
| Rückumschlag | 235 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish