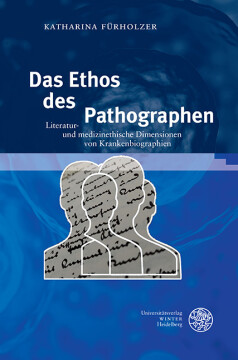
BUCH
Das Ethos des Pathographen
Literatur- und medizinethische Dimensionen von Krankenbiographien
Jahrbuch Literatur und Medizin. Beihefte, Bd. 5
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Wer krank ist, bedarf eines besonderen ethischen Schutzes. Gerade Verfassern von Pathographien bzw. Krankenbiographien kommt daher eine spezifische Verantwortung zu, gerät in ihren Texten doch ein Mensch in den Blick, der aufgrund von Krankheit in hohem Maße vulnerabel, also verletzbar und schutzbedürftig ist. Diese Verantwortung wird bislang unterschätzt. Das vorliegende Buch schließt diese Lücke, indem es die medizinethische Sensibilität für Vulnerabilität und die literaturwissenschaftliche Sensibilität für Schriftlichkeit in Einklang bringt. Methodisch verankert in den Medical Humanities, werden hierzu Textsorten aus Medizin und Literatur einer gattungsethisch orientierten Textanalyse unterzogen. Die Arbeit, die weniger als Antwortgeber denn als grundlegender Problemaufriss konzipiert ist, strebt dabei nach einer Definition und Diskussion ethischer Kategorien, die für die pathographische Arbeit besondere Relevanz haben – mit anderen Worten: Sie strebt nach einem Ethos des Pathographen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | C | ||
| Titel | iii | ||
| Impressum | iv | ||
| Danksagung | vii | ||
| Inhaltsverzeichnis | ix | ||
| I Einleitung | 1 | ||
| II Grundlegungen | 7 | ||
| 1 Forschungsfeld | 9 | ||
| 1.1 Medical Humanities | 9 | ||
| 1.2 Literatur und Medizin | 11 | ||
| 2 Forschungsinteresse | 13 | ||
| 2.1 Problemaufriss | 13 | ||
| 2.2 Forschungsfrage | 17 | ||
| 2.3 Forschungsansatz | 18 | ||
| 3 Forschungsgegenstand | 21 | ||
| 3.1 Gattungen | 21 | ||
| 3.2 Pathographik | 23 | ||
| 3.2.1 Historische Entwicklung | 23 | ||
| 3.2.2 Illness Narratives | 26 | ||
| 3.3 Korpus | 30 | ||
| 3.3.1 Begriffsinstrumentarium | 30 | ||
| 3.3.2 Textkorpus | 32 | ||
| 3.4 Kontext | 33 | ||
| III Der öffentliche Blick | 39 | ||
| 1 Vulnerabilität: Schutzbedürftige Kranke (Kinder- und Jugendliteratur) | 43 | ||
| 1.1 Zum Schutz des Kindes | 44 | ||
| 1.1.1 Kindeswohl | 44 | ||
| 1.1.2 Kindeswille | 45 | ||
| 1.1.3 Kindgemäßheit | 46 | ||
| 1.1.4 Kinder- und Jugendliteratur | 48 | ||
| 1.2 Vulnerable Rezipienten | 50 | ||
| 1.2.1 Holmsen/Midthun: ‚Rasmus på sykehus‘ | 50 | ||
| 1.2.2 Herausforderung ‚Krankenhaus | 52 | ||
| 1.2.3 Vermittlungsebenen | 53 | ||
| 1.2.3.1 Intermediale Ebene | 53 | ||
| 1.2.3.2 Institutionelle Ebene | 54 | ||
| 1.2.3.3 Vorleseebene | 55 | ||
| 1.3 Vulnerable Figuren | 58 | ||
| 1.3.1 Gaarder: ‚I et speil, i en gåte‘ | 58 | ||
| 1.3.2 Eltern Skotbu | 59 | ||
| 1.3.3 Cecilie Skotbu | 61 | ||
| 1.4 Vulnerable Autoren | 64 | ||
| 1.4.1 Pohl/Gieth: ‚Jag saknar dig, jag saknar dig‘ | 64 | ||
| 1.4.2 Tina Dubois: Fiktive Figur | 66 | ||
| 1.4.3 ... reale Autorin: Kinna Gieth | 69 | ||
| 1.4.4 Berufsautor Peter Pohl | 72 | ||
| 2 Schriftlichkeit: Berichtenswerte Singularität (Fallberichte | 77 | ||
| 2.1 Kasuistische Bestimmungen | 78 | ||
| 2.1.1 Beobachtung und Beschreibung | 78 | ||
| 2.1.2 Epistemische Gattungen | 80 | ||
| 2.1.3 Singuläre Vulnerabilität | 82 | ||
| 2.2 Patientenperspektiven | 84 | ||
| 2.2.1 CARE-Leitlinien | 84 | ||
| 2.2.2 Patientenstimmen | 86 | ||
| 2.2.3 Beispielanalyse eines Fallberichts | 87 | ||
| 2.3 Ärztliche Perspektiven | 93 | ||
| 2.3.1 (Fach-)Sprache | 93 | ||
| 2.3.2 …und Wirkung | 94 | ||
| 2.4 Im Medium der Schrift | 96 | ||
| 2.4.1 Exkurs: Schriftdiskurse | 96 | ||
| 2.4.2 Öffentliche Pathographien | 100 | ||
| 2.4.3 Schriftlichkeit als Empowerment | 102 | ||
| IV Der innere Blick | 105 | ||
| 1 Relationalität: Krankheit in Beziehung (Angehörigenpathographien | 107 | ||
| 1.1 Pflegende Angehörige | 109 | ||
| 1.1.1 Angehörige in der Pflicht | 109 | ||
| 1.1.2 Bergman/Bergman/von Rosen: ‚Tre Dagböcker‘ | 112 | ||
| 1.1.3 Ingmar Bergman | 113 | ||
| 1.1.3.1 Abnorme Alltäglichkeit | 113 | ||
| 1.1.3.2 Mise en Scène öffentlicher Intimität | 114 | ||
| 1.1.4 Maria von Rosen | 116 | ||
| 1.1.4.1 Zur Sorge verpflichtet | 116 | ||
| 1.1.4.2 Ersetzte Elternschaft | 120 | ||
| 1.1.5 Diaristisches Residuum | 121 | ||
| 1.2 Hinterbliebene Angehörige | 123 | ||
| 1.2.1 Tafdrup: ‚Tarkovskijs heste‘ | 123 | ||
| 1.2.2 Krankheit | 124 | ||
| 1.2.2.1 Vergessen | 124 | ||
| 1.2.2.2 Verschiebung | 127 | ||
| 1.2.3 Tod | 130 | ||
| 1.2.3.1 Verlust | 130 | ||
| 1.2.3.2 Erinnerung | 133 | ||
| 1.2.4 Poetologie ethischer Trauer | 135 | ||
| 1.3 Schreibende Angehörige | 136 | ||
| 1.3.1 Mazzarella: ‚Hem från festen‘ | 136 | ||
| 1.3.2 Aporien der Autorschaft | 138 | ||
| 1.3.2.1 Biographisch-anamnestisches Konglomerat | 138 | ||
| 1.3.2.2 Anthropologischer Holismus | 140 | ||
| 1.3.2.3 Kant’sche Selbstzweckverstöße | 142 | ||
| 1.3.3 Mutmaßlicher Wille und Autorschaft | 147 | ||
| 2 Korrelationalität: Leser-Autor – Patient-Arzt (Ärztliche Patientenberichte | 153 | ||
| 2.1 Patientenakte und ärztlicher Bericht | 154 | ||
| 2.1.1 Inhalt und Funktion | 154 | ||
| 2.1.2 Arztbriefe | 155 | ||
| 2.1.3 Elektronische Patientenakten | 158 | ||
| 2.2 Ärztliche Autoren | 161 | ||
| 2.2.1 Sensible Materie | 161 | ||
| 2.2.2 Beispielanalyse eines ärztlichen Patientenberichts | 164 | ||
| 2.2.2.1 Exkludierende Fachsprache | 166 | ||
| 2.2.2.2 Vercodierte Patienten | 169 | ||
| 2.2.2.3 Anonyme Autoren | 171 | ||
| 2.3 Pathographische Beziehungen | 173 | ||
| 2.3.1 Vom Narrativ zum Bericht | 173 | ||
| 2.3.1.1 Übertragungsprozesse | 173 | ||
| 2.3.1.2 Übertragungsverluste | 176 | ||
| 2.3.2 Pathographische Identitäten | 178 | ||
| 2.3.2.1 Patient: Identitätskonstruktion | 178 | ||
| 2.3.2.2 Arzt: Identitätsreflexion | 180 | ||
| 2.3.3 Uninformed consent | 181 | ||
| V Der eigene Blick | 185 | ||
| 1 Selbst-Bestimmung: Zur Ästhetik des Defizits (Autopathographien | 189 | ||
| 1.1 Lesarten | 189 | ||
| 1.1.1 Tranströmer: ‚Den stora gåtan‘ | 189 | ||
| 1.1.2 Aphasiologie | 190 | ||
| 1.1.3 Textanalyse | 192 | ||
| 1.1.3.1 Pathographische Lesarten | 192 | ||
| 1.1.3.2 Existenzielle Vergänglichkeit | 194 | ||
| 1.1.3.3 Berufliche Vergänglichkeit | 197 | ||
| 1.1.3.4 Kommentar zur Analyse | 199 | ||
| 1.1.4 Gattungsanalyse | 201 | ||
| 1.1.4.1 Aphasische Lyrik | 201 | ||
| 1.1.4.2 Metaphorische Aphasie | 206 | ||
| 1.1.4.3 Aphasische Metaphorik | 209 | ||
| 1.2 Schreibarten | 211 | ||
| 1.2.1 Hagabakken: ‚Biografi. Dikt og Tekster‘ | 211 | ||
| 1.2.2 Textanalyse | 212 | ||
| 1.2.2.1 Auftakt: Im Kreuzfeuer | 212 | ||
| 1.2.2.2 Pathologische Zeitrechnungen | 214 | ||
| 1.2.2.3 Klinische Einsamkeit | 215 | ||
| 1.2.2.4 Biographische Neukartierung | 217 | ||
| 1.2.2.5 Existenzielle Funktionsverluste | 219 | ||
| 1.2.3 Gattungsanalyse | 221 | ||
| 1.2.3.1 Intermediale Identitätsverweise | 221 | ||
| 1.2.3.2 Architextuelle Identitätssedimente | 224 | ||
| 1.2.4 Wie viel Identität hat der Mensch | 228 | ||
| 2 Selbstbestimmung: Zwischen Rekonstruktion und Antizipation (Patientenverfügungen | 231 | ||
| 2.1 Bestimmungsgrenzen | 232 | ||
| 2.1.1 Selbstbestimmung | 232 | ||
| 2.1.2 Fremdbestimmung | 234 | ||
| 2.1.3 Beispielanalyse einer Musterverfügung | 237 | ||
| 2.1.3.1 Entscheidungsgrundlagen | 237 | ||
| 2.1.3.2 Beispielinterpretation | 242 | ||
| 2.2 Gattungsgrenzen | 244 | ||
| 2.2.1 Zwischen Biographie und Autobiographie | 244 | ||
| 2.2.1.1 Rekonstruktion | 245 | ||
| 2.2.1.2 Antizipation | 247 | ||
| 2.2.2 Zwischen Biographie und Pathographie | 250 | ||
| 2.2.3 Pathographische Codierungen | 252 | ||
| 2.2.3.1 Grenzüberschreitungen | 252 | ||
| 2.2.3.2 Krankheitssemantiken | 255 | ||
| VI Schlussbemerkungen | 259 | ||
| VII Literaturverzeichnis | 265 | ||
| Backcover | 287 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish