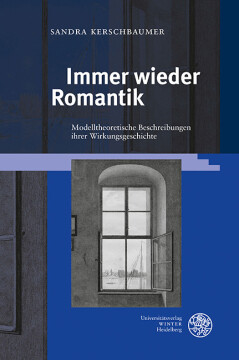
BUCH
Immer wieder Romantik
Modelltheoretische Beschreibungen ihrer Wirkungsgeschichte
Jenaer germanistische Forschungen. Neue Folge, Bd. 43
2018
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Wie konnte das historische, sich um 1800 in Jena und Berlin konstituierende Phänomen ‚Romantik‘ in zeitlich späteren Phasen bis in die Gegenwart hinein fortwirken? Bereits im 19. Jahrhundert wird wahrgenommen, dass Begriffsverwendungen und die mit ‚dem Romantischen‘ verbundenen Vorstellungen sich pluralisieren. Seither versucht man zu verstehen, in welchem Verhältnis die historische Romantik zu ihren in viele gesellschaftliche Bereiche ausgreifenden Fortschreibungen steht. Dies kann mit Hilfe von modelltheoretisch grundierten Analysen nun besser gelingen. Über die Bedeutung von Modellen und über ihre zentrale Rolle für die Wissenschaft ist man sich vielerorts einig. Der Erkenntnisfortschritt durch die Analyse und die Anwendung von Modellen wird von der Literaturwissenschaft allerdings bisher unterschätzt. Deshalb werden im vorliegenden Buch klassische und neueste modelltheoretische Positionen auf ihre Verwendbarkeit hin gesichtet und konkret für das Verständnis von Rezeptionsprozessen fruchtbar gemacht.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | Cover | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Einleitung | 7 | ||
| Teil 1 Modellbildungen | 17 | ||
| 1.1 Exempel aus der Literatur | 17 | ||
| 1.1.1 August Wilhelm Schlegels Vorlesungen – Prinzipien der Modellbildung | 17 | ||
| 1.1.2 Mme de Staëls „De l’Allemagne“ – die Zweiseitigkeit der Modellbildung | 29 | ||
| 1.1.3 Heinrich Heines „Romantische Schule“ – die Bedeutung der „Modellinstanz“ | 33 | ||
| 1.2 Exempel aus der Musik | 38 | ||
| 1.2.1 E.T.A. Hoffmanns Rezension der 5. Sinfonie Ludwig van Beethovens – die Transportfunktion von Modellen | 38 | ||
| 1.3 Exempel aus der Bildkunst | 46 | ||
| 1.3.1 Caspar David Friedrich – Modell ohne Romantik-Begriff | 46 | ||
| 1.4 Diagramm zu Modellbildungsprozessen in der Rezeptionsgeschichte | 51 | ||
| Teil 2 Anwendung und Rekonstruktion abstrakter Modelle | 53 | ||
| 2.1 Darstellungsmodelle | 58 | ||
| 2.1.1 Liszts Programmmusik als Anwendung eines romantischen Modells | 58 | ||
| 2.1.2 Romantische Literaturkritik | 60 | ||
| 2.2 Deutungs- und Handlungsmodelle | 65 | ||
| 2.2.1 Romantische Liebe | 65 | ||
| 2.2.2 Romantische Kinder | 72 | ||
| 2.3 Diagramm zur Rekonstruktion abstrakter Modelle | 85 | ||
| Teil 3 Ein wissenschaftliches Modellangebot | 87 | ||
| 3.1 Das reduzierende Herausarbeiten einer Struktur | 90 | ||
| 3.1.1 Die historische Matrix um 1800 | 90 | ||
| 3.1.2 Die erweiterte Matrix der Rezeptionsgeschichte | 98 | ||
| 3.1.3 Die erweiterte Matrix der Forschungsgeschichte | 104 | ||
| 3.2 Das ‚Modell Romantik‘ | 110 | ||
| 3.3 Der epistemologische Status des Modells | 113 | ||
| 3.4 Modellanwendungen: Beispiele, Ausblicke | 119 | ||
| 3.4.1 ‚Modell Romantik‘ und die Stadt | 119 | ||
| 3.4.2 ‚Modell Romantik‘: Populäre Musik der Gegenwart | 125 | ||
| 3.5 Diagramm zur wissenschaftlichen Modellbildung | 131 | ||
| Schluss | 133 | ||
| Literatur- und Quellenverzeichnis | 137 | ||
| Backcover | 158 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish