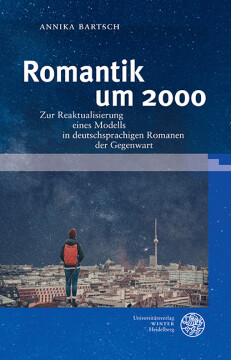
BUCH
Romantik um 2000
Zur Reaktualisierung eines Modells in deutschsprachigen Romanen der Gegenwart
Jenaer germanistische Forschungen. Neue Folge, Bd. 44
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
In der Literatur der Gegenwart lässt sich eine auffällige Bezugnahme auf romantische Denkfiguren und damit verbundene Erkenntnisansprüche und Darstellungsformen feststellen. Was aber ist damit gemeint, wenn Literatur um 2000 als ‚romantisch‘ bezeichnet wird, und in welchem Verhältnis steht die Gegenwartsliteratur dabei zur historischen Strömung um 1800? Die Reaktualisierung der Romantik lässt sich durch eine modelltheoretische Perspektive besser verstehen und beschreiben. Ausgehend von der historischen Strömung entwickelt die vorliegende Studie daher ein Modell ‚Romantik‘ als Bezugspunkt, um die Art und Weise sowie die Funktion und poetologische Bedeutung der Reaktualisierung der Romantik in deutschsprachigen Gegenwartsromanen zu analysieren. Exemplarisch werden Modellierungen der Romantik in Texten von Felicitas Hoppe, Wolfgang Herrndorf, Helmut Krausser, Thea Dorn und Hans-Ulrich Treichel untersucht, in denen verschiedene Spielarten des Romantischen um 2000 sichtbar werden.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Danksagung | 9 | ||
| Einleitung | 11 | ||
| Teil I: Methodologische Vorbemerkungen: Romantik als Modell | 27 | ||
| 1 Reaktualisierung als Traditionsverhalten | 27 | ||
| 2 Reaktualisierung als Verhältnis von Referenzobjekt und referierenden Texten | 30 | ||
| 2.1 Bestimmung der Konstituenten: die referierenden Texte und das Referenzobjekt | 31 | ||
| 2.2 Bestimmungsmöglichkeiten des Zusammenhangs von referierenden Texten und Referenzobjekt | 32 | ||
| 3 Das Modell als Referenzobjekt der referierenden Texte | 36 | ||
| 3.1 Was ist ein Modell? | 36 | ||
| 3.2 Das Modell ‚Romantik‘ als Referenzobjekt der Reaktualisierung | 45 | ||
| Teil II: Das Modell ‚Romantik‘ | 53 | ||
| 4 Romantik als Antwort | 55 | ||
| 4.1 Problemgeschichtlich perspektivierte Literaturgeschichte: Literatur als Reaktion auf Problemkonstellationen | 56 | ||
| 4.2 Der Problemhorizont um 1800 | 60 | ||
| 5 Die romantische Antwort | 76 | ||
| 5.1 Bezug auf ein höchstes Prinzip | 78 | ||
| 5.2 Denkfiguren ästhetischer Repräsentation | 91 | ||
| 5.3 Konkrete Textphänomene: Bildbereiche und Verfahren | 101 | ||
| Teil III: Analyse der referierenden Texte: Das Modell ‚Romantik‘ in der Gegenwartsliteratur | 111 | ||
| 6 Felicitas Hoppe | 120 | ||
| 6.1 ‚Paradiese, Übersee‘ (2003) | 123 | ||
| 6.1.1 Identität im Spannungsfeld von „Aufbruch, Unterwegssein und Heimkehr“ | 126 | ||
| 6.1.1.1 Doppelgängermotivik | 128 | ||
| 6.1.1.2 Raumzeitliche Ordnung? | 137 | ||
| 6.1.2 Transzendentalpoesie durch Wirklichkeitsmultiplizierung | 142 | ||
| 6.1.2.1 Wirklichkeitserzeugung durch Sprache | 143 | ||
| 6.1.2.2 Integration des Wunderbaren | 146 | ||
| 6.1.2.3 Narrative Strategien zur Konstruktion pluraler Wirklichkeiten | 149 | ||
| 6.1.2.4 „Poesie und Poesie der Poesie“ – transzendentalpoetische Metanarration | 152 | ||
| 6.2 Zwischenfazit: Das Modell ‚Romantik‘ Hoppe – Die romantische Schwebe als Erkenntnismodus | 155 | ||
| 7 Wolfgang Herrndorf | 162 | ||
| 7.1 ‚Diesseits des Van-Allen-Gürtels‘ (2007) | 164 | ||
| 7.1.1 Bedeutungskostitution zwischen Einzelerzählung und Erzählungsband | 165 | ||
| 7.1.2 „Diesseits des Van-Allen-Gürtels“ | 170 | ||
| 7.2 ‚Tschick‘ (2010) | 177 | ||
| 7.2.1 Struktur und Erzählkonzept: Maik als autodiegetischer Erzähler | 179 | ||
| 7.2.2 Der Roadtrip als romantische Reise | 182 | ||
| 7.2.2.1 Aufbruchsgrund und Plan-, Zweck- und Ziellosigkeit der Reise | 183 | ||
| 7.2.2.2 Befreiung des empfindenden Ichs im Erleben von Natur und Umwelt | 186 | ||
| 7.2.2.3 Reflexion der zeitlichen Einbettung des Moments durch das erzählende Ich | 192 | ||
| 7.3 Zwischenfazit: Das Modell ‚Romantik‘ Herrndorf – Welt- und Selbstdeutung des Subjekts | 197 | ||
| 8 Helmut Krausser | 202 | ||
| 8.1 ‚Thanatos. Das schwarze Buch‘ (1996) | 205 | ||
| 8.1.1 Johanser als romantisches Subjekt? – Johansers Modell von Romantik | 207 | ||
| 8.1.1.1 Romantik als Weltflucht | 208 | ||
| 8.1.1.2 Die erste Stufe von Johansers Ich-Dissoziation: Der Mord an Benedikt | 215 | ||
| 8.1.1.3 Die zweite Stufe der Ich-Dissoziation: Thanatos – Todestrieb und Todesgott | 217 | ||
| 8.1.2 Romantische Strukturanleihen: narrative Verfahren und Formen | 221 | ||
| 8.1.3 ‚Thanatos‘ als Modellobjekt des Modells ‚Romantik‘? | 224 | ||
| 8.2 ‚UC‘ (2003) | 227 | ||
| 8.2.1 Arndt Hermannsteins Schizophrenie – mögliche Ursachen und Deutungen | 228 | ||
| 8.2.1.1 Samuel Kurthes’ Hyperchronos-Theorie als Interpretament des Romans | 230 | ||
| 8.2.1.2 Andersens Märchen als Interpretament des Romans: metaleptische Autorhierarchie in ‚UC‘ | 233 | ||
| 8.3 Zwischenfazit: Kraussers Bezugnahme auf das Modell ‚Romantik‘ – Rezeptionshinterfragung und Instrumentalisierung | 239 | ||
| 9 Romantik-Bezug ohne Reaktualisierung des Modells ‚Romantik‘? | 242 | ||
| 9.1 Hans-Ulrich Treichel: ‚Tristanakkord‘ (2000) | 242 | ||
| 9.2 Thea Dorn: ‚Die Unglückseligen‘ (2016) | 254 | ||
| Schlussbemerkungen | 263 | ||
| 10 Das Modell ‚Romantik‘: Reaktion auf eine gegenwärtige Problematik. Synthese und Fazit | 263 | ||
| 11 Das Modell ‚Romantik‘ in synchroner und diachroner Perspektive. Anschlussmöglichkeiten und Ausblick | 273 | ||
| Siglenverzeichnis | 275 | ||
| Literaturverzeichnis | 277 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 311 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish