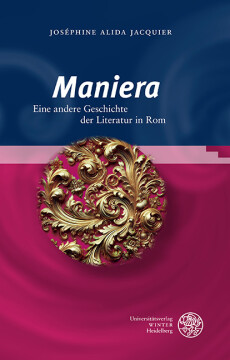
BUCH
‚Maniera‘
Eine andere Geschichte der Literatur in Rom
Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, Neue Folge, 2. Reihe, Bd. 166
2025
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Im Zentrum dieser Studie stehen diejenigen Texte der römischen Literatur, die die ältere Literaturgeschichte – im Hinblick auf die Klassik oder „Goldene Latinität“ – etwas müde als „Nachklassik“ oder „Silberne Latinität“ bezeichnet hat. Die wuchernde Rhetorik dieser Texte, ihre schiere Lust am Effekt und am mitunter grausamen Bild kategorisiert Ernst Robert Curtius in seinem epochemachenden Werk ‚Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter‘ (1948) mit dem der Kunstgeschichte entlehnten, überhistorisch verstandenen Begriff des „Manierismus“ und profiliert ihn als Konstante der europäischen Literatur. Die römische Literatur von der augusteischen Zeit bis an die Schwelle zur christlichen Literatur soll in dieser Studie in ihrer manieristischen Prägung perspektiviert werden. Die Streifzüge in die moderne Literatur zeigen, dass die in der manieristischen Literatur Roms ausgebildeten Denkfiguren auch in der Moderne nichts von ihrer Prägekraft verloren haben. Dass die an den Texten aufgezeigten Strukturen auch in den Werken der antiken wie der modernen manieristischen Kunst zu finden sind, bezeugt ihre Relevanz als Kriterien für eine manieristische Literatur.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | 1 | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 7 | ||
| 1 Einleitung: Der Manierismus als geistesgeschichtliches Phänomen: ein Tableau | 11 | ||
| 1.1 Vorüberlegungen | 11 | ||
| 1.2 Forschungsüberblick | 15 | ||
| 1.3 Der Manierismus als ewiger ‚revenant‘ | 18 | ||
| 1.4 ‚Ornatus‘ als pathologisches Phänomen oder als Form der Intensität | 20 | ||
| 1.5 Der Manierismus als kapriziöse Geisteshaltung | 26 | ||
| 1.6 Von Zicken und (falschen) Müttern: Manieristische Literatur als ‚écriture féminine‘ | 28 | ||
| 1.7 Fortschritt oder Warum die manieristische Literatur nicht von der Stelle kommt | 31 | ||
| 1.8 Die Relation von Wort und Bild in der manieristischen Literatur | 40 | ||
| 1.9 Das Gerade und das Krumme in der manieristischen Literatur | 45 | ||
| 1.10 Manieristische Literatur als Literatur des Fluiden | 47 | ||
| 2 Lektüren | 57 | ||
| 2.1 Augusteische Zeit | 57 | ||
| 2.1.1 Ovid oder Wie alles begann | 57 | ||
| 2.1.2 Die Poetik der Korallen (Ov. met. 4, 740–752) oder „Der Baum ist kein gutes Bild“ (Darwin) | 58 | ||
| 2.1.3 ‚Narrat Agenorides‘…doch Medusa sieht man nicht (Ov. met. 4, 772–803) | 63 | ||
| 2.1.4 Exkurs: Monströse Ordnungen in der Kunst der augusteischen Zeit | 68 | ||
| 2.1.5 Ovids ‚Tristien‘ zwischen Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit | 73 | ||
| 2.2 Neronische Zeit | 77 | ||
| 2.2.1 Neronische Zeit: M. Annaeus Lucanus | 77 | ||
| 2.2.1.1 Lucan oder ‚Un poëte de talent dont l’éducation a gâté le naturel‘ (Désiré Nisard) | 77 | ||
| 2.2.1.2 Das Proömium des ‚De bello civili‘ oder die Sprache der ‚dis-cordia‘ | 78 | ||
| 2.2.1.3 Zentren der Zwietracht und ikonische Konkordanz I: Weltensturz und das ‚cingere urbem‘ der Erinye (Bell. civ. 1, 523–583) | 84 | ||
| 2.2.1.4 Zentren der Zwietracht und ikonische Konkordanz II: Die Restitution der Ordnung und das ‚lustrum‘ der Priester (Bell. civ. 1, 584–609) | 88 | ||
| 2.2.1.5 Von Zentrum zu Zentrum zu Zentrum…: Arruns’ Hepatoskopie (Bell. civ. 1, 609–638) | 90 | ||
| 2.2.1.6 ‚Como un centro‘: Lucans Ästhetik im Spiegel von Baltasar Graciáns Verständnis des ‚concepto‘ | 92 | ||
| 2.2.1.7 ‚Caesa caput Gorgon‘: Lucans Medusa oder die Kreation aus der Dissoziation (Bell. civ. 9, 619–699) | 97 | ||
| 2.2.2 Neronische Zeit: L. Annaeus Seneca | 107 | ||
| 2.2.2.1 Seneca oder ‚Je est un autre‘ | 107 | ||
| 2.2.2.2 Senecas ‚Thyestes‘ oder Warum das Bild wichtiger ist als der Plot | 108 | ||
| 2.2.3 Neronische Zeit: Petronius Arbiter | 119 | ||
| 2.2.3.1 Monströses Design: Petrons ‚Satyrica‘ im Zeichen des Kreises | 119 | ||
| 2.3 Flavische Zeit bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. | 135 | ||
| 2.3.1 M. Valerius Martialis | 135 | ||
| 2.3.1.1 Vom fleißigen Bienchen und dem übermütigen Zündler. Martials Epigramm 4, 32 als „stille“ Pointe | 135 | ||
| 2.3.2 Flavische Zeit bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr.: P. Papinius Statius | 143 | ||
| 2.3.2.1 Statius trifft auf Vergil: Pathos im Fegefeuer der ‚Divina Commedia‘ | 143 | ||
| 2.3.2.2 Ikonische Prägnanz in der Schwebe I: Statiusʼ Silve 2, 3 über den Baum des Atedius Melior (mit Exkurs zu Góngoras ‚Fábula de Polifemo y Galatea‘) | 145 | ||
| 2.3.2.3 Ikonische Prägnanz in der Schwebe II: Statius’ „Ode an den Schlaf“ (Silvae 5, 4) | 159 | ||
| 2.3.4 Flavische Zeit bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr.: C. Suetonius Tranquillus | 205 | ||
| 2.3.3 Flavische Zeit bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr.: D. Iunius Iuvenalis | 169 | ||
| 2.3.3.1 Juvenals erste Satire: Die ‚maniera‘ als sozialer und ästhetischer Code einer neuen ‚urbanitas‘ | 169 | ||
| 2.3.3.2 In der Großstadt(-satire): Die (un-)wirklichen Leiden eines satirischen ‚underdog‘ | 180 | ||
| 2.3.3.3 Exkurs: Die ‚maniera‘ als sozialer und ästhetischer Code in Patrizia Cavallis ‚Con passi giapponesi‘ (2019) | 188 | ||
| 2.3.3.4 Exkurs: Das Monströse der ‚maniera‘ in Patrizia Cavallis Gedicht ‚La maestà barbarica‘ | 196 | ||
| 2.3.4 Flavische Zeit bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr.:C. Suetonius Tranquillus | 205 | ||
| 2.3.4.1 Suetons ‚Vita Neronis‘: Das ‚Monströse‘ des ‚style impassible‘ | 205 | ||
| 2.4 Manieristische Literatur der Spätantike | 213 | ||
| 2.4.1 Ausoniusʼ Mosella als eine Poetik des Fluiden | 213 | ||
| 2.4.2 Zeitenwende. Eulalias Text-Körper zwischen Hyperbolik und Transzendenz (Prudentiusʼ ‚Peristephanon‘ III) | 227 | ||
| 3 Conclusio | 239 | ||
| 3.1 Kriterien für eine manieristische Literatur | 239 | ||
| 3.1.1 Begrenzte Fülle | 239 | ||
| 3.1.2 Radikale Ikonizität | 240 | ||
| 3.1.2.1 Der Text als Körper | 241 | ||
| 3.1.2.2 Das literale Denken | 242 | ||
| 3.1.2.3 Abstrakte Formensprache | 243 | ||
| 3.1.3 Manieristische Intensität | 244 | ||
| 3.1.3.1 ‚Huis clos‘ in Zeit, Raum und Struktur | 244 | ||
| 3.1.3.2 (Serielle) Reihung | 246 | ||
| 3.1.4 In der Schwebe | 246 | ||
| 3.1.5 (Un-)Mittelbarkeit | 249 | ||
| 3.1.6 Manieristisches Schreiben als ‚écriture féminine‘ | 252 | ||
| 3.2 Das Ende und weiter | 253 | ||
| 4 Dank | 255 | ||
| 5 Abbildungsverzeichnis | 257 | ||
| 6 Literaturverzeichnis | 259 | ||
| 6.1 Literatur | 259 | ||
| 6.1.1 Textausgaben | 259 | ||
| 6.1.2 Kommentare | 260 | ||
| 6.1.3 Übersetzungen | 261 | ||
| 6.2 Forschungsliteratur | 262 | ||
| 7 Index | 277 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish