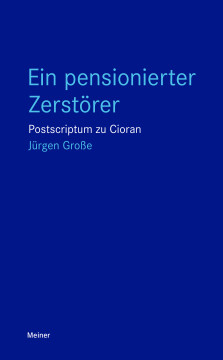
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Der rumänisch-französische Dichterphilosoph E. M. Cioran (1911–1995) wird zumeist entweder als Schriftsteller oder als Denker wahrgenommen. Jürgen Große zeigt in seiner Studie hingegen, dass eine scharfe Trennung inadäquat ist und dass Ciorans schriftstellerisches Werk aus einer tiefen Vertrautheit mit der europäischen wie außereuropäischen philosophischen Überlieferung erwachsen ist. Ziel des Buches ist es, Ciorans Denken vom Ruf des Exzentrischen, ja Launenhaften zu befreien. Cioran war einer der großen Leser des 20. Jahrhunderts. Noch dem kleinsten Essay gingen monate-, mitunter jahrelange Quellenstudien voraus. Ciorans Schreiben und Denken ist somit alles andere als spontan oder stimmungshaft, auch wenn es sich oftmals so gibt. Es ist dem akademischen Denk- und Darstellungsstil allerdings entgegengesetzt: Der affektive Gehalt von Metaphysiken und Moralsystemen wird nicht unterdrückt, um vermeintlich affektbefreite, objektive Erkenntnis zu gewinnen, sondern vielmehr explizit gemacht. Cioran war, abweichend von dogmatisch-religiösen wie liberal-säkularen Geistestraditionen des Okzidents, kein Denker, der für richtig erkannte Ideen mit der Rhetorik des besseren Arguments lediglich illustrierte. Vielmehr wollte er »Ideen in Manien verwandeln«, sich »der Mythologien und der Theologien für indirekte Vertraulichkeiten« bedienen. Der philosophische Schriftsteller im Sinne Ciorans macht sich selbst zum Austragungsort versteckter oder unentfalteter Ambivalenzen. Er nutzt seine Affekte, um den affektiven Gehalt philosophischer und weltanschaulicher Wertsetzungen bloßzulegen. Die Studie zeichnet Ciorans Denken und Schreiben anhand von zwölf thematischen Brennpunkten nach.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Cover | U1 | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 5 | ||
| Prolog: 'Das normalste Wesen aller Zeiten' | 9 | ||
| 1. Der Intellektuelle als Märtyrer | 17 | ||
| Paris als Hauptstadt des Westens und seiner Intellektuellen | 19 | ||
| Westlicher Geist als Martyrium | 26 | ||
| Der Intellektuelle als Märtyrer des Lebens | 32 | ||
| 2. Aspekte westlichen Bewußtseins | 37 | ||
| Geist als Indikator: der Maßstab Reflexion | 41 | ||
| Geist als Faktor: Fanatismus der Idee | 48 | ||
| Selbstbewußtsein und schlechtes Gewissen | 60 | ||
| 3. Die Schlaflosigkeit des Geistes | 69 | ||
| Ursprung der Schlaflosigkeit | 70 | ||
| Phänomenologie der Übernächtigung | 75 | ||
| Ressentiment und Rücksichtslosigkeit | 78 | ||
| Philosophieskepsis | 81 | ||
| Literaturbegriff | 85 | ||
| Erlösung Ermüdung? | 89 | ||
| Epilog: Gott in der Nacht | 93 | ||
| 4. Gnosis, Gnostizismus und Dualismus | 95 | ||
| Gnosis und Dualismus | 98 | ||
| Fanatismen | 103 | ||
| Gnosis oder Gnostizismus? | 108 | ||
| 5. 'Der Skeptiker ist ein verfehlter Mystiker' | 117 | ||
| 6. Nietzsche, Klages und das Ressentiment | 133 | ||
| Dankbarkeit im Bösen | 134 | ||
| Nietzsches Lehre vom Ressentiment | 135 | ||
| Klages' Nietzsche-Kritik | 138 | ||
| Leben als Empörungstat | 140 | ||
| Gnosis, Skepsis, Moralistik | 142 | ||
| Ressentiment in Politik und Kultur | 144 | ||
| Die Idolatrie des Werks | 146 | ||
| 'Schaffen heißt seine Leiden hinterlassen' | 149 | ||
| Zynismus | 150 | ||
| 'Wem soll ich zürnen?' | 151 | ||
| Weisheit durch Ermüdung | 152 | ||
| Nietzsche – ein Utopist | 154 | ||
| 7. Trauer und Melancholie: zur Philosophie der Stimmungen | 157 | ||
| Philosophischer Aufstieg der Melancholie | 158 | ||
| Geistige Potenzen der Trauer | 161 | ||
| Mißtrauen gegen die Melancholie als Intellektuellen-Selbstkritik | 164 | ||
| Linke Melancholie und germanische Ironieresistenz | 165 | ||
| Metaphysiken der Stimmung | 167 | ||
| Gegen Heidegger | 169 | ||
| Philosophische Korrumpierbarkeit | 171 | ||
| Melancholie – eine unpersönliche Unruhe | 172 | ||
| Philosophische Überlegenheit des Schriftstellers | 175 | ||
| 8. Zweierlei Romantik | 179 | ||
| Verluste | 182 | ||
| Sehnsüchte | 186 | ||
| Zeitgenossenschaft | 192 | ||
| 9. Exzeß der Mitte: Cioran und Pascal (I) | 197 | ||
| 'Die Eleganz der Angst' | 198 | ||
| Grenzenloser Selbstzweifel, begrenztes Menschenwesen | 199 | ||
| Befreiung und Gehemmtheit | 200 | ||
| Gefahren des Hochmuts | 202 | ||
| Skeptizismus und die korrumpierte Verzweiflung | 203 | ||
| Vorteile der Krankheit | 205 | ||
| Philosophie? | 206 | ||
| Unvermittelte Gnade | 207 | ||
| Fromme Heiden, profanierte Christen | 209 | ||
| Richtig zweifeln | 210 | ||
| Ein Denker für Ungläubige | 212 | ||
| 10. Ennui ohne Verklärung: Cioran und Pascal (II) | 215 | ||
| Metamorphosen der Langeweile | 216 | ||
| Selbstermächtigung und Sinnentleerung | 218 | ||
| Entfremdete Welt, versteinerte Zeit | 219 | ||
| Analogie von Langeweile und Zweifel | 220 | ||
| Seinsmangel und Willensehrgeiz | 222 | ||
| Allein mit der Zeit | 223 | ||
| Zeit, Geschichte und Verhängnis | 225 | ||
| Die Langeweile der Philosophen | 227 | ||
| Leid oder Langeweile | 229 | ||
| Verstehen durch Verzicht | 230 | ||
| Vom Ennui zum Cafard | 231 | ||
| 11. 'Über einen, der in Ideen macht': Sartre, der Zeitgenosse | 233 | ||
| 'Ich habe eine religiöse Dimension. Die hat er sicher nicht.' | 237 | ||
| Das Drama des Bewußtseins | 242 | ||
| Geist, Zweifel und Verneinung | 248 | ||
| Häresien der Bürgerlichkeit | 253 | ||
| Philosophie und Literatur | 259 | ||
| Jenseits des Engagements | 268 | ||
| 12. Cioran als Erfolgsautor | 273 | ||
| Die drei Ordnungen | 276 | ||
| Was ist Mißerfolg? | 283 | ||
| Unerfüllbare Wünsche | 291 | ||
| Epilog: 'Dieses Gezücht von Glossatoren' | 295 | ||
| Siglen | 303 | ||
| Nachweise | 307 | ||
| Personenregister | 309 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish