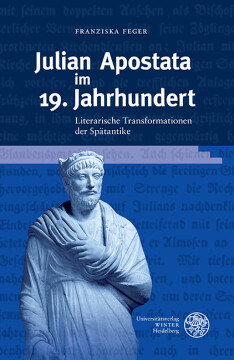
BUCH
Julian Apostata im 19. Jahrhundert
Literarische Transformationen der Spätantike
Beihefte zum Euphorion, Bd. 108
2019
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Julian Apostata, der letzte römische Kaiser, der dem antiken Polytheismus anhing, war schon zu Lebzeiten eine kontroverse Figur. Sein früher Tod 363 n.Chr. hat seither kontrafaktische Gedankenspiele einer nicht-christlichen Postantike provoziert. Bis heute ist umstritten, ob es ihm bei längerem Leben gelungen wäre, die Konstantinische Wende rückgängig zu machen. Im 19. Jahrhundert avanciert er zu einer populären Projektionsfigur, mit der man religiöse Standpunkte aushandelt, politische Gegner attackiert, aber auch ästhetische und wissenschaftliche Diskurse befeuert. Die literarische Selbstartikulation durch Julian durchzieht Dichtung, Historiographie, Schullektüre und Presse. Julian faszinierte Schriftsteller ersten Ranges, darunter Schiller, Eichendorff, Ibsen, Strindberg und C.F. Meyer, ebenso wie Laienautoren. Die germanistische Studie ergründet die Ursachen für das gesteigerte Interesse an Julian im 19. Jahrhundert und untersucht Formen seiner zeitgenössischen Aktualisierung.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhalt | 5 | ||
| Vorwort | 9 | ||
| I Einleitung | 11 | ||
| 1 Forschungsstand | 22 | ||
| 2 Spätzeitvorstellungen, geschichtstheoretische Voraussetzungen und epochenspezifische Konstellationen | 28 | ||
| 2.1 Die Spätantike als Krisenspiegel der Moderne | 31 | ||
| 2.2 Geschichtsdichtung zwischen Fiktionalität und Faktualität | 44 | ||
| 3 Quellen und Struktur | 58 | ||
| II Voraussetzungen und Anfänge der Julian-Dichtung des langen 19. Jahrhunderts | 69 | ||
| 1 Der Facettenreiche. Erneute Perspektivenvielfalt auf Julian im Zeitalter der Aufklärung | 69 | ||
| 1.1 Historiographische Korrektur des Julian-Bilds | 70 | ||
| 1.2 Ideologische Inanspruchnahme: Julian als Toleranzdenker | 73 | ||
| 1.3 Friedrich II. als Julian | 83 | ||
| 2 Der Klassizist und der Verkannte. (Spät-)Aufklärerische Julian-Pläne – Schiller, Kotzebue, Novalis und A. Müller | 91 | ||
| III Julian und die Romantik | 111 | ||
| 1 Der ‚Antichrist‘. Rückkehr zu mittelalterlichen Deutungsmustern und nationalistische Indienstnahme | 114 | ||
| 1.1 „Schillerus redivivus“? Neue dramatische Versuche (Kettenburg, Schirach, Brause, Hebbel | 114 | ||
| 1.2 Christlich-germanische Heroik bei Friedrich de la Motte Fouqué | 122 | ||
| 1.3 Erotisch-pantheistische Reize und verführbares Christentum. Eichendorffs neuer Julian-Mythos | 142 | ||
| 2 Der Rationalist und der Romantiker. Wider die theologischen Denkmuster der Romantik | 161 | ||
| 2.1 Rationalismus als Heilmittel gegen Unglauben | 161 | ||
| 2.2 Vexierbild zweier Romantiker auf dem Thron. David Friedrich Strauß und seine Kritiker | 174 | ||
| 3 Der Konvertit. Solidarität oder Unverständnis? – Julian aus Sicht der Judenchristen Neander und Robert | 199 | ||
| 3.1 EXKURS. Eine jüdische Adaption des Konversionsmotivs: „Sepphoris und Rom“ (1866) | 216 | ||
| 4 Fazit | 233 | ||
| IV Politisierungen Julians im Drama von der Märzrevolution bis zum Kulturkampf | 237 | ||
| 1 Der Usurpator. Ein Paradigma neu erlangter Demokratie | 245 | ||
| 1.1 Monarchistisch-konservative Stimmen | 245 | ||
| 1.2 Sozialdemokratische Agitation | 248 | ||
| 2 Der Kirchengegner. Kulturkampf in Vergangenheit und Gegenwart | 262 | ||
| 2.1 Von Martyrien und gescheiterten Ehen. Ein Plädoyer für die katholische Kirche | 268 | ||
| 2.2 Pfaffenschelte und Germanenkult. Antikatholische Propaganda und Deutschtümelei im Zeichen Bismarcks | 286 | ||
| 3 Fazit | 293 | ||
| V Zwischen Wissenschaft und Dichtung | 295 | ||
| 1 Der Historische und der Fiktive. Georg Pfahlers „Julian der Abtrünnige“ – ein Beispiel für die Arbitrarität der Gattungen Populärhistoriographie und Professorenroman? | 303 | ||
| 2 Der Linksrheinische. Nationalistische Schreibweisen: Wissenschaftsprosa und Professorenroman bei Felix Dahn und Gustav Freytag | 309 | ||
| 3 Der Autor und der ‚Antichrist‘. Vokabeltests und Abenteuer, humanistische und moralische Lektionen für die reifere Jugend | 333 | ||
| 3.1 Christlich-moralisierende Erzählungen ‚für Jugend und Volk‘ | 338 | ||
| 3.2 Labadye – Cüppers – Ohl: Intertextuelle Bezüge und motivische Abgrenzungen des Jugendbuchs | 344 | ||
| 4 Fazit | 353 | ||
| VI Ibsen und die Folgen | 355 | ||
| 1 Der Liminale. Utopien vom Dritten Reich und einem Goldenen Zeitalter | 358 | ||
| 1.1 Zwischen Kulturkrise und Idealismuskritik: Henrik Ibsens „Kaiser und Galiläer“ | 362 | ||
| 1.2 Produktive Ibsen-Rezeption: Von Merežkovskijs Theokratie-Konzept zum Dritten-Reich-Gedanken bei Moeller van den Bruck und Thomas Mann | 384 | ||
| 1.3 Ein verhinderter Messias? August Strindbergs „Historische Miniaturen“ | 399 | ||
| 2 Der Gläubige. ‚Neue Religiosität‘ in der Lyrik um 1900 | 413 | ||
| 2.1 Reinkarnationslehre in C.F. Meyers „Der sterbende Julian“ | 417 | ||
| 2.2 Vitalismus und nietzscheanische Götterdämmerung: Die Julian-Gedichte René Schickeles und Albert Ehrensteins | 434 | ||
| 3 Fazit | 453 | ||
| VII Fazit | 457 | ||
| ANHANG | 467 | ||
| Bibliographie der untersuchten Texte des langen 19. Jahrhunderts | 467 | ||
| Siglenverzeichnis | 477 | ||
| Abbildungsverzeichnis | 478 | ||
| Abbildungsnachweis | 479 | ||
| Literaturverzeichnis | 480 | ||
| Quellen | 480 | ||
| Forschungsliteratur | 504 | ||
| Rückumschlag | 551 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish