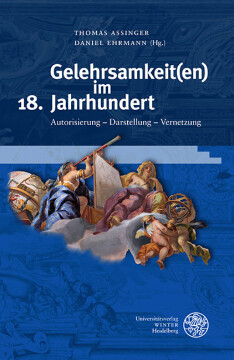
BUCH
Gelehrsamkeit(en) im 18. Jahrhundert
Autorisierung – Darstellung – Vernetzung
Herausgeber: Assinger, Thomas | Ehrmann, Daniel
Beihefte zum Euphorion, Bd. 116
2022
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Für eine Kulturgeschichte des Wissens ist das 18. Jahrhundert von entscheidender Bedeutung. In den Verhandlungen um das Erbe der frühneuzeitlichen Gelehrtenkultur und den Konflikten, die sich daraus entspinnen, formieren sich Künste und Wissenschaften als zunehmend spezialisierte Disziplinen. Die Gelehrsamkeit bleibt in dieser großen Transformation aber nur scheinbar auf der Strecke. Mit seiner interdisziplinären Kombination von Fallstudien bietet der Band Einblick in unterschiedliche Konstellationen der gelehrten Autorisierung, Darstellung und Vernetzung von Wissen wie auch seiner Akteure im 18. Jahrhundert. Damit wird die Geschichte von Konzepten und Praktiken der Gelehrsamkeit erkundet, ihre Bezüge zu diskursiven und infrastrukturellen Kontexten (Sprachen, Gattungen, Medien, Institutionen) werden erläutert und genutzte wie verpasste Möglichkeiten ihrer Modernisierung bilanziert.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| Vorbemerkung | 7 | ||
| Thomas Assinger, Daniel Ehrmann: Zur Einführung: Gelehrsamkeit zwischen Gelehrtenkultur und Wissenschaftskultur | 9 | ||
| Darstellung | 35 | ||
| Heinrich Bosse: Sprachenwechsel in der gelehrten Republik | 35 | ||
| Roman Kuhn: Epische Fußnoten Gelehrsamkeit und Gelehrsamkeitssatire in Voltaires Anmerkungen zur ‚Henriade‘ und zur ‚Pucelle‘ | 55 | ||
| Hole Rößler: Von der ‚Imago‘ zum ‚Image‘ Konstruktionen von Gelehrsamkeit im druckgrafischen Porträt des 18. Jahrhunderts | 73 | ||
| Autorisierung | 103 | ||
| Franz M. Eybl: Diskursivierte Praktiken, Praktiken der Diskursivierung. Polyhistorische Buntschriftstellerei und populäre Hausmedizin bei Johann Justus Winckelmann und Christian Franz Paullini | 103 | ||
| Thea Sumalvico: Von ‚Volksheiligtümern‘ und ‚vernünftiger Religion‘ Die Produktion von ‚Gelehrten‘ und ‚Laien‘ in theologischen Debatten des 18. Jahrhunderts | 125 | ||
| Sebastian Engelmann, Philipp Reichrath: ‚Dorfgelehrte‘ – Die soziale Funktion von lokalen Gelehrten in der Volksaufklärung anhand von Johann Georg Schlossers ‚Katechismus der Sittenlehre für das Landvolk‘ | 161 | ||
| Maximilian Lässig: Johann Christian Schmohl (1756–1783) – Vom Bauernsohn zum Gelehrten | 141 | ||
| Vernetzung | 177 | ||
| Anett Lütteken: Johann Jacob Breitinger – Profil(e) eines Zürcher Gelehrten | 177 | ||
| Agnes Amminger: Der ‚gelehrte Musicus‘ Leopold Mozart (1719–1787) und seine ‚Gründliche Violinschule‘: Ein Instrumentallehrbuch als außerakademische Qualifikationsschrift | 195 | ||
| Andree Michaelis-König: Szenen der Konfrontation, der Interaktion und der Kollaboration von christlicher und jüdischer Gelehrsamkeit im 18. Jahrhundert | 217 | ||
| Joëlle Weis: Praktiken im Netzwerk: Historisch-kritische Gelehrte und ihre ‚Community of Practice‘ | 233 | ||
| Anne Purschwitz: Im Netz des (gelehrten?) Wissens – Die halleschen Zeitungen und Zeitschriften der Aufklärungsepoche (1688–1815) | 251 | ||
| Katrin Löffler: Wider die „nichts nützenden Zänckereyen“. Gelehrte und Streitkultur in Rezensionszeitschriften | 269 | ||
| Thomas Fuchs: Das Leipziger Verlagswesen und die Beschreibung von Gelehrsamkeitum 1800 | 287 | ||
| Verzeichnis der Autor:innen | 301 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish