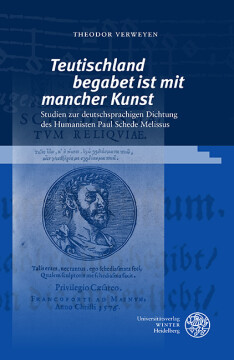
BUCH
‚Teutischland begabet ist mit mancher Kunst‘
Studien zur deutschsprachigen Dichtung des Humanisten Paul Schede Melissus
Herausgeber: Srb, Wolfgang | Verweyen, Andreas
Beihefte zum Euphorion, Bd. 121
2023
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Dass es neben dem kolossalen neulateinischen Œuvre des Humanisten Paul Schede Melissus (1539–1602) auch ein kleines und in Teilen feines literarisches Werk in deutscher Sprache gibt, war allererst zu entdecken und in den verschiedensten Kontexten – französischer Psalmendichtung und internationaler Motettenkunst, der Kasualpoesie so gut wie der ‚Vulgaris cantio‘ und geselligen Liedausübung, nicht zuletzt aber auch der literarischen Reformbemühungen der Zeit im Rahmen der rinascimentalen ‚imitatio‘-Poetik – zu beschreiben und hinsichtlich der formästhetischen Leistung zu analysieren. Nicht zu den wenigsten Verdiensten Julius Wilhelm Zincgrefs ist dabei zu zählen, dass er Teile dieses bislang ignorierten, jedoch zum Gesamtwerk des Melissus gehörenden Schaffens in seiner verkannten Anthologie von 1624 „gerettet“ hat.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Widmung | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| Vorbemerkung | 9 | ||
| I. Biographische und prosopographische Akzentuierungen | 13 | ||
| 1. Dichten als Schicksal | 15 | ||
| 2. Pfälzische Widmungspoesie im Kontext höfischer Politik | 18 | ||
| 3. Widmungspoesie unter der Bedingung von Gratifikation und Loyalität | 23 | ||
| II. Texte und Kontexte | 25 | ||
| 1. Kryptogragrammatisches Spiel und Spielarten | 25 | ||
| 2. Dedikation und Intertextualität | 34 | ||
| III. Deutsche „Cantica“ und Poemata im Kraftfeld der Psalmenübersetzung des Melissus aus dem Französischen | 39 | ||
| 1. Der 128. Psalm: ein ‚petrarkistisches Epithalamium‘ oder ein „Ehepsalm“? | 39 | ||
| 2. Ein geistlicher Gesang aus der mosaischen Gesetzestafel | 44 | ||
| 3. Heilsgeschichtliche Hoffnung – ein Lobgesang | 48 | ||
| 4. Geistliche Dichtung in Akrosticha | 51 | ||
| Exkurs: Italienreise | 64 | ||
| IV. Dichten aus Anlass – lateinisch und deutsch: im Kontext des Nürnberger Musiklebens der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts | 69 | ||
| V. „Cantiones musicae“ – Vielstimmigkeit: musikalisch – lingual – poetisch | 83 | ||
| VI. Neue Ansätze lyrischer Formkultur in deutscher Sprache – mit Blick auf die Anthologie Julius Wilhelm Zincgrefs | 113 | ||
| 1. Die deutschen Epithalamien des Melissus | 114 | ||
| a) Ein Hochzeitsgedicht als erstes deutsches Alexandrinersonett | 114 | ||
| b) „Brautlied“, geschrieben ‚bei Gelegenheit‘ | 128 | ||
| 2. Die deutschen Lieder des Melissus – mit Rücksicht auf die „Frischen Teutschen Liedlein“ Georg Forsters | 139 | ||
| c) „Rot Röslein“ – Mythos, sprachliche Säkularisation und Lyrik | 140 | ||
| d) „Morgens eh’s tages schein“ – Metamorphose und lyrische Poesie | 161 | ||
| e) „HJn vnd wider / auff vnd ab“ – Lyrische Dichtkunst und Kulturpatriotismus kryptisch | 171 | ||
| VII. Ergebnisse | 185 | ||
| Anhang I-VIII | 195 | ||
| Abbildungen | 229 | ||
| Literaturverzeichnis | 239 | ||
| Personenregister | 261 | ||
| Dank | 265 | ||
| Rückumschlag | Rückumschlag |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish