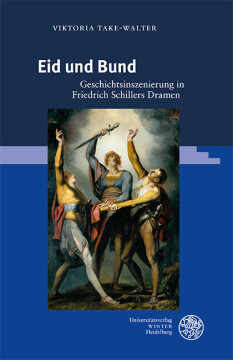
BUCH
Eid und Bund
Geschichtsinszenierung in Friedrich Schillers Dramen
Beihefte zum Euphorion, Bd. 123
2024
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Mit der „Räuberbande“ seines ersten Dramas erprobt Schiller eine bühnenpolitische Signatur, die sich mit dem Freundschaftsbund zwischen Karlos und Posa, Wallensteins „Bündnis widern Hof“ bis hin zum „uralt, Bündnis von Väter Zeit“ (‚Wilhelm Tell‘) zu einem theatralen ,Muster‘ verfestigt: Publikumswirksam werden in den Dramen immer wieder Bünde beschworen, Eide geleistet, Allianzen beschlossen – und im Laufe der Handlung auf den Prüfstand gestellt. In seinen Werken stellt Schiller meist historische Modellsituationen in ihrer theatralen Gegenwärtigkeit aus, und zwar als vor Augen geführte Verschwörung. Deutete die ältere Schiller-Forschung diese Handlungselemente als Szenenkomplexe, in denen sich „die Verwandlung der Vaterordnung in eine Brüderordnung“ (G. Kaiser) vollzöge, analysiert die vorliegende Studie Schillers Arbeit an den Quellen als spezifische, am Muster von Eid und Bund geschulte, ästhetische Überformung der Historiographie. Es wird der Frage nachgegangen: Wie inszeniert Schiller (überlieferte) Geschichte?
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Umschlag | Umschlag | ||
| Titel | 3 | ||
| Impressum | 4 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 5 | ||
| I Einleitung | 9 | ||
| 1 Schillers dramatische Verschwörungen und Rebellionen – Aspekte einer bühnenpolitischen Signatur | 11 | ||
| 2 Methodik. Theatralität und Geschichte | 27 | ||
| 2.1 Der Eid: Gottesbeweis, iudicium, Gründungsfigur? | 32 | ||
| 2.2 Performativität der dramatischen ‚Bünde‘ | 37 | ||
| 2.3 ‚coniurationes‘ zwischen Fiktionalität und Faktualität: Auf Spurensuche in Schillers historiographischen Prätexten (Intertextualität) | 41 | ||
| 2.4 ‚Historische Wahrheit‘ vs. ‚Kunstwahrheit‘ | 44 | ||
| II Schillers dramatische Schwurgemeinschaften | 51 | ||
| 3 „Wir schwören dir Treu und Gehorsam bis in den Tod“: ‚Die Räuber‘ (1781) | 53 | ||
| 3.1 Einleitung und Forschungsüberblick | 53 | ||
| 3.2 Verwünschung und Verbündung in den Räubern | 60 | ||
| 3.2.1 Franz Moor (I, 1): Verfluchung des Bruders | 61 | ||
| 3.2.2 Die Räuberhauptmänner – oder: Utopisten an den Grenzen des Rechts (Karl Moor, Moritz Spiegelberg) | 65 | ||
| 3.2.3 Motivation der Räuberbande, ‚more judaico‘ und Bündnis(aus)schluss (‚Gründungsszene‘: I, 2) | 68 | ||
| 3.3 Bekräftigung des Bundes – Bündnisszenen (II, 3; III, 2; IV, 5) | 76 | ||
| 3.3.1 Zweiter Akt. Dritte Szene | 76 | ||
| 3.3.2 Dritter Akt. Zweite Szene | 80 | ||
| 3.3.3 Vierter Akt. Fünfte Szene | 82 | ||
| 3.4 „Treuloser, wo sind deine Schwüre?“ Widerrufung des Bundes und Katastrophe (V, 2) | 86 | ||
| 3.5 Kapitelfazit | 88 | ||
| 4 „Laßt uns den heldenmüthigen Bund durch eine Umarmung beschwören“: ‚Die Verschwörung des Fiesko zu Genua‘ (1783) | 91 | ||
| 4.1 Schillers erstes Geschichtsdrama: Rezeption und Deutung | 94 | ||
| 4.2 Motivation der Verschwörung | 107 | ||
| 4.2.1 Sacco, Kalkagno und das Bild einer interessengeleiteten Unterstützerschaft (I, 3) | 107 | ||
| 4.2.2 Ein republikanischer Tugendwächter: ‚Gründungsvater‘ Verrina | 111 | ||
| 4.2.3 Die Gründungsszene (I, 12) und Verrinas Rache-Eid | 114 | ||
| 4.3 Bündnisszenen (II, 17 & 18; III, 5) | 119 | ||
| 4.3.1 Theatrale Referentialität des Eides | 119 | ||
| 4.3.2 Dramatische Performanzen: „Schreibt!“ Fieskos Verhältnis zu seinen Mitverschwörern | 121 | ||
| 4.3.3 Muley Hassan: Informant und Verräter der Konspiration | 130 | ||
| 4.3.4 Revolte und Reversion | 132 | ||
| 4.4 Montierte Topographie | 133 | ||
| 4.5 Kapitelfazit | 138 | ||
| 5 „Arm in Arm mit dir, / So fordr’ ich mein Jahrhundert in die Schranken“: Der Freundschaftsbund in Dom Karlos (1785/1787) | 143 | ||
| 5.1 Schillers Dramatisierung der ‚Histoire de Dom Carlos‘ (1691[1672]) von Abbé St. Réal und Robert Watsons ‚Geschichte der Regierung Philipps des Zweyten‘ (1778) | 147 | ||
| 5.2 „Der Karlos-Komplex“23: Forschung und Textgenese | 149 | ||
| 5.3 Fragiles Zentrum: Philipp II. hat einen Eid geschworen | 158 | ||
| 5.4 Der Freundschaftsbund zwischen Karlos und Posa | 160 | ||
| 5.4.1 Erinnerung an ein Opfer aus Kindertagen: erzählte ‚Gründungsszene‘ (I, 2) | 160 | ||
| 5.4.2 Erweiterung und Veredelung des Bundes: Dom Karlos – Elisabeth (I, 5) | 164 | ||
| 5.4.3 Ambivalente Bekräftigungen der Brüderlichkeit: Bündnisszenen (I, 7;I, 9) | 168 | ||
| 5.5 Schillers Streichung der Bündnis-Einsegnung gegenüber dem Thalia-Fragment | 173 | ||
| 5.6 Kapitelfazit | 175 | ||
| 6 „Parole müssen sie mir geben, eidlich, schriftlich“: Doppelte Verschreibung und ‚Eidespflicht‘ in den ‚Piccolomini‘ (1798-1800) | 181 | ||
| 6.1 Entstehung und Anlage der Trilogie | 187 | ||
| 6.2 Forschungsdiskussion | 196 | ||
| 6.3 Der ‚prägnante Moment‘: die drohende Absetzung Wallensteins und das „Bündniß wider’n Hof“ (Die ‚Piccolomini‘) | 201 | ||
| 6.3.1 Die Bankettszene als Schauplatz von Wallensteins hybrider Kriegsführung | 202 | ||
| 6.3.2 Die historische Situation und die Quellen: Erster und Zweiter ‚Pilsener Schluß‘ | 203 | ||
| 6.4 Schillers Adaption des Pilsener Treuerevers | 205 | ||
| 6.4.1 Schillers dramatische Adaption des „Pilsener Treuerevers“: Die Bankettals „Bündnisszene“ (‚Piccolomini‘, Zweiter Aufzug) | 206 | ||
| 6.4.2 Darstellung des Treueversprechens in der Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs | 211 | ||
| 6.4.3 Zusammenfassung des Vergleichs | 218 | ||
| 6.5 Einblick in die historiographischen Vorlagen | 220 | ||
| 6.5.1 Christoph Gottlieb Murr: ‚Beyträge zur Geschichte des berühmten kaiserlichen Generalissimus Albrechts, Herzog von Friedland‘ (1790) | 221 | ||
| 6.5.2 Johann Christian Herchenhahns ‚Geschichte Albrechts von Wallenstein, des Friedländers‘ (1791) | 226 | ||
| 6.5.3 Frantz Christoph Khevenhüllers ‚Annales Ferdinandei‘ (1726) | 232 | ||
| 6.6 Kapitelfazit | 237 | ||
| 7 „Weil sie den Ränken vertraut, den bösen Künsten der Verschwörung“: Zur Mortimer-Handlung in ‚Maria Stuart‘ (1801) | 243 | ||
| 7.1 Einleitung: Marias Helfer: Darstellung eines jesuitischen Komplotts vor dem Hintergrund der Gegenreformation | 243 | ||
| 7.2 Forschungsdiskussion | 246 | ||
| 7.3 Der Verschwörungskomplex im Verhältnis zu den geschichtlichen Quellen | 255 | ||
| 7.3.1 Die Mortimer-Episode | 256 | ||
| 7.3.2 Die Schuldfrage und der zweifelhafte Eid | 264 | ||
| 7.4 Kapitelfazit | 268 | ||
| 7.5 Inspirationsquellen aus der englischen Dramatik: John Banks ‚The Albion Queens‘ (1704) und John St. Johns ‚Mary, Queen of Scots‘ (1789) | 270 | ||
| 7.5.1 John Banks ‚The Albion Queens‘: Or, the death of Mary, Queen of Scotland (1704) | 272 | ||
| 7.5.2 John St. Johns ‚Mary, Queen of Scots‘ (1789) | 276 | ||
| 7.5.3 Verschwörer als Vorbildfiguren in St. Johns Tragödie: Norfolk, Babington und der „infernal plot“ | 283 | ||
| 8 Alter und neuer Bund, Geschichte und Mythos: Die schweizerische Eidgenossenschaft in ‚Wilhelm Tell‘ (1804) | 291 | ||
| 8.1 Dramatisierung eines „Volksgegenstands“: Zu den Entstehungsvoraussetzungen des ‚Tell‘ | 291 | ||
| 8.2 Forschungsdiskussion | 300 | ||
| 8.3 Die Ur-Gemeinschaft, der Schwur der Rekruten und ein kollektiver Eid: serielle Bündnisbekräftigungen am Rütli | 309 | ||
| 8.3.1 Erster Bündnisschwur: die Ur-Gemeinschaft (Erster Aufzug, Vierte Szene) | 310 | ||
| 8.3.2 Die Gründungsszene am Rütli (Zweiter Aufzug, Zweite Szene) | 311 | ||
| 8.3.2.1 Episierende Tendenzen I: Der erzählte Schwur der Rekruten (Melchthals Botenbericht) | 311 | ||
| 8.3.2.2 „So schwör ich droben bei den ew’gen Sternen“: Begründung und Zielrichtung der ‚Verschwörung‘ | 313 | ||
| 8.3.2.3 Episierende Tendenzen II: Stauffachers Erzählung von der Schweizer Besiedelung, oder: ‚Etwas über die erste Menschengesellschaft‘ (1789) | 318 | ||
| 8.3.2.4 Zur Performativität des Gründungs-Eides: „Wir sind Ein Volk, und einig wollen wir handeln“ | 321 | ||
| 8.3.2.5 Begründung des Eides und Rechtfertigung | 323 | ||
| 8.3.2.6 Ende der Versammlung und Modulation des Bündnisses: „Lasst uns den Eid des neuen Bundes schwören“ | 329 | ||
| 8.4 Schillers Arbeit an den Quellen | 332 | ||
| 8.4.1 Aegidius Tschudis ‚Chronicon Helveticum‘ (1734 [1570]) | 334 | ||
| 8.4.2 Johannes Müllers Geschichten schweizerischer Eidgenossenschaft (die ersten drei Teile, 1786–1795) | 341 | ||
| 8.5 Kapitelfazit | 349 | ||
| III Resümee | 355 | ||
| 9 Dramenübergreifende Perspektiven | 357 | ||
| 10 Schluss | 373 | ||
| IV Anhang | 375 | ||
| 11 Literaturverzeichnis | 377 | ||
| 11.1 Primärliteratur | 377 | ||
| 11.1.1 Werke von Friedrich Schiller | 377 | ||
| 11.1.2 Schillers Quellen / weitere Primärtexte | 379 | ||
| 11.2 Sekundärliteratur | 381 | ||
| 12 Dank | 395 |


 Publishing Platform by CloudPublish
Publishing Platform by CloudPublish