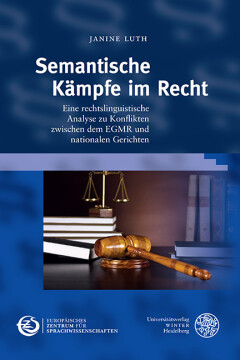
BUCH
Semantische Kämpfe im Recht
Eine rechtslinguistische Analyse zu Konflikten zwischen dem EGMR und nationalen Gerichten
Schriften des Europäischen Zentrums für Sprachwissenschaften (EZS), Bd. 1
2015
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Der rechtslinguistische Zugang zu juristischen Texten gibt Aufschluss über Deutungsoptionen umstrittener Fachkonzepte. Dieser text- und diskursorientierte Ansatz ist für die Analyse der Kommunikation zwischen internationalen und nationalen Gerichten besonders erhellend, da hier die sprachliche Konstitution von Faktizität häufig mit gesteigerter Intensität geführt wird. Die Arbeit untersucht die Aushandlungsprozesse um nationalstaatliche Souveränität und Kompetenzverschiebungen anhand einer Sprachhandlungstypologie. Dabei werden sprachlich geronnene Konfliktlinien bei der Harmonisierung von nationalem Recht und Völkerrecht herausgestellt, deren Beschreibung als semantische Kämpfe im Kern der Betrachtung stehen. Als Beispiel dient der Sorgerechtsstreit ‚Görgülü‘. Durch die Untersuchung des Fachdiskurses und seiner Transformation in Medientexte können Vermittlungsprobleme aufgedeckt werden, wodurch ein Beitrag zur Transparenz bei der rechtsstaatlichen Faktizitätsherstellung geleistet wird.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Danksagung | 5 | ||
| Inhalt | 7 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 11 | ||
| 1 Einleitung | 15 | ||
| 1.1 Einleitende Gedanken | 15 | ||
| 1.2 Erkenntnisleitendes Interesse und Fragestellung | 17 | ||
| 1.3 Gang der Untersuchung | 20 | ||
| 1.4 Auswahl des Untersuchungsfalls und Vorbemerkungen zum Korpus | 21 | ||
| 2 Das europäische Rechtssystem im Wandel | 23 | ||
| 2.1 Rechtslinguistischer Forschungsstand | 23 | ||
| 2.2 Linguistische Ansätze für das Europa- und Völkerrecht | 26 | ||
| 2.3 Der Europäische Gerichtshof in Straßburg: Entstehung und Entwicklung | 29 | ||
| 2.3.1 Entstehungsgeschichte | 29 | ||
| 2.3.2 Reform | 31 | ||
| 2.3.3 Auslegung und Rechtsprechung des EGMR | 34 | ||
| 2.4 Die rechtstheoretische Auseinandersetzung mit Auslegungsfragen | 36 | ||
| 3 Theoretische Grundannahmen | 43 | ||
| 3.1 Sprache, Welt und Wissen | 43 | ||
| 3.2 Semantik und Pragmatik | 47 | ||
| 3.3 Fachsprache und Gemeinsprache | 48 | ||
| 4 Spuren der Verflechtung: Text und Diskurs | 55 | ||
| 4.1 Textdimensionen | 55 | ||
| 4.1.1 Analyse von Rechtstexten | 56 | ||
| 4.1.2 Analyse von Printmedientexten | 57 | ||
| 4.1.3 Analyse von Aufsätzen in (juristischen) Fachzeitschriften | 60 | ||
| 4.2 Vom Text zur Diskursanalyse: Theoretischer Hintergrund | 62 | ||
| 4.3 Zwischenfazit | 65 | ||
| 5 Methoden | 67 | ||
| 5.1 Erhebung und Auswahl des Textkorpus | 67 | ||
| 5.1.1 Entscheidungstexte der Gerichte | 67 | ||
| 5.1.2 Gutachten und Stellungnahmen | 70 | ||
| 5.1.3 Die juristischen Fachaufsätze | 71 | ||
| 5.1.4 Printmedientexte | 72 | ||
| 5.2 Terminologische Abgrenzung | 74 | ||
| 5.3 Untersuchung der primären Fachtexte (Entscheidungen und Gutachten | 76 | ||
| 5.3.1 Ausgangspunkt: "Die Strukturierende Rechtslehre" | 76 | ||
| 5.3.2 Inhaltsseitige Untersuchungsebene der Entscheidungstexte | 78 | ||
| 5.3.3 Inhaltsseitige Untersuchungsebene der Gutachten | 79 | ||
| 5.3.4 Das Paradigma der "Semantischen Kämpfe" | 80 | ||
| 5.4 Untersuchung der Printmedientexte | 82 | ||
| 6 Diskursakteure und Normtexte | 87 | ||
| 6.1 Gerichtsentscheidungen im Überblick | 87 | ||
| 6.2 Der Fall Görgülü: Eigene Sachverhaltsdarstellung | 88 | ||
| 6.3 Die Normtexte und Gesetzeskommentare | 89 | ||
| 6.3.1 Die Normtexte des GG | 90 | ||
| 6.3.2 Die Normtexte des BGB | 94 | ||
| 6.3.2.1 Elterliche Sorge – Normtexte | 96 | ||
| 6.3.2.2 Umgangsrecht – Normtexte | 101 | ||
| 6.3.3 Die Normtexte der EMRK | 104 | ||
| 6.4 Zwischenergebnis | 108 | ||
| 7 Untersuchung anhand der Sprachhandlungstypen | 109 | ||
| 7.1 Sachverhalt-Festsetzen: Sprecherhandlungen und Sprechereinstellungen | 109 | ||
| 7.1.1 Beschluss des AG Wittenberg vom 09.03.2001 | 109 | ||
| 7.1.2 Beschluss des OLG Naumburg vom 20.06.2001 | 114 | ||
| 7.1.3 Urteil des EGMR vom 26.02.2004 | 117 | ||
| 7.1.4 Beschlüsse des OLG Naumburg aus dem Jahre 2004 | 121 | ||
| 7.1.5 Beschluss des BVerfG (2. Senat) vom 14.10.2004 | 124 | ||
| 7.1.6 Beschlüsse des BVerfG (1. Senat) aus den Jahren 2004 und 2005 | 125 | ||
| 7.1.7 Beschluss des OLG Naumburg vom 15.12.2006 | 127 | ||
| 7.1.8 Beschlüsse des BVerfG (1. Senat) vom 09.02.2007 | 128 | ||
| 7.1.9 Beschluss des BGH vom 26.09.2007 | 132 | ||
| 7.1.10 Zwischenfazit | 133 | ||
| 7.2 Sachverhalt-Entscheiden: Sprecherhandlungen und Sprechereinstellungen | 134 | ||
| 7.2.1 Entscheiden: Beschluss des AG Wittenberg vom 09.03.2001 | 134 | ||
| 7.2.2 Entscheiden: Beschluss des OLG Naumburg vom 20.06.2001 | 136 | ||
| 7.2.3 Entscheiden: Urteil des EGMR vom 26.02.2004 | 138 | ||
| 7.2.4 Entscheiden: Beschluss des OLG Naumburg vom 30.06.2004 und 09.07.2004 | 141 | ||
| 7.2.5 Entscheiden: Beschluss des BVerfG vom 14.10.2004 | 145 | ||
| 7.2.6 Entscheiden: Beschluss des OLG Naumburg vom 08.12.2004 und 20.12.2004 | 148 | ||
| 7.2.7 Beschlüsse des BVerfG aus dem Jahr 2004 und 2005 | 152 | ||
| 7.2.8 Entscheiden: Beschluss des OLG Naumburg vom 15.12.2006 | 158 | ||
| 7.2.9 Entscheiden: Beschluss des BGH vom 26.09.2007 | 163 | ||
| 7.3 Fall Görgülü: Beendigung des Rechtstreits | 166 | ||
| 7.4 Bestandsaufnahme und Zwischenfazit | 166 | ||
| 8 Semantische Kämpfe im Fachdiskurs zum Fall Görgül | 171 | ||
| 8.1 Kontroverse um den Kindeswohlbegriff in der Bezugswissenschaft | 172 | ||
| 8.2 Semantische Kämpfe um das Leitkonzept ›Kindeswohl‹ | 177 | ||
| 8.3 Bedeutungsfixierungsversuche anhand von Subkonzepten | 181 | ||
| 8.4 Semantische Kämpfe um den Familienbegriff | 193 | ||
| 8.5 Semantische Kämpfe um den Berücksichtigungsbegriff | 197 | ||
| 8.6 Methodenreflexion: Implizite semantische Kämpfe im Recht | 204 | ||
| 9 Die Gutachten und Stellungnahmen im Fall Görgül | 207 | ||
| 9.1 Untersuchung anhand von Sprachhandlungstypen | 209 | ||
| 9.1.1 Psychologische Stellungnahme H. K. vom 29.01.2001 | 209 | ||
| 9.1.2 Ergänzende psychologische Stellungnahme H. K. vom 03.05.2004 | 212 | ||
| 9.1.3 Fachpsychologisches Gutachten I. E. vom 28.12.2004 | 215 | ||
| 9.1.4 Gutachten K. G. vom 11.06.2006 | 220 | ||
| 9.2 Konzepte in den Gutachten | 223 | ||
| 9.3 Einflechten der Gutachten in die Entscheidungstexte | 225 | ||
| 9.4 Zwischenfazit | 231 | ||
| 10 Das Medienkorpus in der qualitativen Untersuchung | 233 | ||
| 10.1 Untersuchungen auf der Ebene der Lexeme und Syntagmen | 237 | ||
| 10.2 Semantischer Kampf auf der Bezeichnungs- und Bedeutungsebene | 243 | ||
| 10.3 Untersuchungen auf der Ebene des Satzes | 249 | ||
| 10.4 Ebene der Texte: Einflechten der Fachtexte | 261 | ||
| 11 Schlussbetrachtung | 265 | ||
| 11.1 Ausgangsfragen und Thesen | 266 | ||
| 11.2 Ausblick | 270 | ||
| 12 Quellen- und Literaturverzeichnis | 273 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish