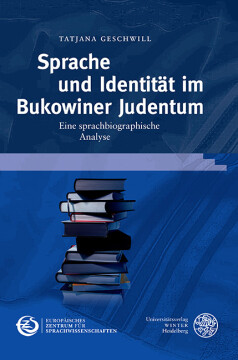
BUCH
Sprache und Identität im Bukowiner Judentum
Eine sprachbiographische Analyse
Schriften des Europäischen Zentrums für Sprachwissenschaften (EZS), Bd. 3
2015
Zusätzliche Informationen
Bibliografische Daten
Abstract
Im Zentrum vorliegender Studie stehen vierzehn im Jahr 2011 erhobene lebensgeschichtliche Erzählungen von Holocaustüberlebenden aus der ehemals vielsprachigen und multikulturellen Bukowina. Charakteristisch für die heute in Israel lebenden Interviewten im Alter zwischen 80 und 92 Jahren ist die sowohl den Besonderheiten der mehrsprachig-aufgeklärten Donaumonarchie als auch den Windungen der Lebensgeschichte geschuldete und bis ins hohe Alter aufrechterhaltene Vielsprachigkeit ebenso wie die zentrale Prägung des Sprachlebens durch das Deutsche. Im Fokus der Arbeit steht die Ermittlung und Dokumentation des Zusammenhangs zwischen sprachlicher Biographie und Identität, zu deren Klärung eine vorgelagerte Abhandlung über die methodische und theoretische Verbindung von Identität und erzählter Lebensgeschichte erfolgt. Anhand der methodischen Praxis der „close-reading“-Interpretation werden anschließend die unterschiedlichen Bewertungsmuster von Sprache gedeutet. Eine systematische Ergänzung der Interpretation zur deutschen Muttersprache bilden die Darstellungen und Deutungen zum Hebräischen, Jiddischen und Rumänischen.
Inhaltsverzeichnis
| Zwischenüberschrift | Seite | Aktion | Preis |
|---|---|---|---|
| Danksagung | VII | ||
| Inhaltsverzeichnis | 1 | ||
| I Einleitung | 5 | ||
| I.1 Gang der Untersuchung | 5 | ||
| I.2 Die Entstehung der Projektidee | 6 | ||
| I.3 Die Erhebung der Interviews | 8 | ||
| I.3.1 Die Kontaktaufnahme | 8 | ||
| I.3.2 Die Anfangserzählung | 10 | ||
| I.3.3 Die immanente Fragephase | 13 | ||
| I.3.4 Die exmanente Fragephase | 13 | ||
| II Die Geschichte der Bukowina | 15 | ||
| II.1 Ein diachroner Forschungsüberblick | 16 | ||
| II.2 Die Bukowina: Von der Entstehung bis zum Zerfalleiner historischen Kulturlandschaft | 25 | ||
| II.2.1 Die soziokulturellen und politischen Entwicklungen der Bukowina während des langen 19. Jahrhunderts | 26 | ||
| II.2.2 Die Situation der Bukowina während des Ersten Weltkriegs | 32 | ||
| II.2.3 Die Bukowina zwischen den beiden Weltkriegen | 33 | ||
| II.2.4 Die Konsequenzen des Zweiten Weltkriegs für die Bukowina | 37 | ||
| II.2.5 Der Mythos Bukowina: Der Diskurs über die „so ziokulturelle Harmonisierung“ des Buchenlandes | 40 | ||
| II.2.6. Mehrsprachigkeit in der Bukowina | 41 | ||
| III Die Korrelation von Erinnerung, Identität und Narrationein: erkenntnistheoretischer Rahmen | 47 | ||
| III.1 Identitätstheoretische Grundlagen | 47 | ||
| III.1.1 (Begriffs)theoretische Überlegungen | 48 | ||
| III.1.2 Die Konzeption von Identität nach Erik H. Erikson | 50 | ||
| III.1.3 Die Konzeption von Identität nach George H. Mead | 52 | ||
| III.1.4 Die Konzeption von Identität nach Paul Ricoeur | 55 | ||
| III.1.5 Die Konzeption von Identität nach Jürgen Straub | 55 | ||
| III.1.6 Resümee | 57 | ||
| III.2 Erinnerung und Identität | 58 | ||
| III.2.1 Die Verbindung von individueller Erinnerung und Identität aus kognitionspsychologischer Sicht | 60 | ||
| III.2.1.1 Das autobiographische Gedächtnis | 61 | ||
| III.2.2 Das kollektive Gedächtnis | 63 | ||
| III.2.2.1 Maurice Halbwachs „Memoire Collective“ | 64 | ||
| III.2.2.2 Die Gedächtniskonzeption nach Jan und Aleida Assmann | 66 | ||
| III.3 Narrative Identitätsbildung | 67 | ||
| III.3.1 Das narrative Interview | 68 | ||
| III.3.2 Die autobiographische Erzählung | 70 | ||
| III.3.3 Motive des Sprechens und Schweigens bei Holocaustüberlebenden | 72 | ||
| IV Das Korpus | 75 | ||
| IV.1 Iulku K. | 76 | ||
| IV.2 Wolfgang G. | 77 | ||
| IV.3 Lucca G. | 80 | ||
| IV.4 Ernie S. | 86 | ||
| IV.5 Joseph W. | 89 | ||
| IV.6 Erika F. | 93 | ||
| IV.7 Sylvia M. | 96 | ||
| IV.8 Hedy B. | 99 | ||
| IV.9 Rita P. | 103 | ||
| IV.10 Margit B. | 104 | ||
| IV.11 Walther und Martha E. | 108 | ||
| IV.12 Sidi G. | 110 | ||
| IV.13 Siegfried G. | 112 | ||
| V Sprachbiographie- und Mehrsprachigkeitsforschung | 113 | ||
| V.1 Mehrsprachigkeitsforschung | 114 | ||
| V.1.1 Inhaltliche Anforderungen an den Zwei- und Mehrsprachigkeitsbegriff | 114 | ||
| V.1.2 Die Anforderungen an den Begriff der Muttersprache in einer mehrsprachigen Region | 119 | ||
| V.2 Grundlagen der Sprachbiographieforschung | 121 | ||
| V.2.1 Die Anfänge der Sprachbiographieforschung | 122 | ||
| V.2.2 Erkenntnisinteresse der Sprachbiographieforschung | 123 | ||
| V.3 Die Verbindung von Sprache und Identität | 125 | ||
| V.3.1 Die Bedeutung von Sprache im Judentum | 129 | ||
| V.3.2 Die identitätsstiftende Funktion der deutschen Sprache im historischen Überblick | 132 | ||
| VI Die Interviewanalyse | 139 | ||
| VI.1 Die deutsche Sprache | 139 | ||
| VI.1.1 Lucca G. | 140 | ||
| VI.1.2 Iulku K. | 142 | ||
| VI.1.3 Ernie S. | 142 | ||
| VI.1.4 Wolfgang G. | 144 | ||
| VI.1.5 Joseph W. | 146 | ||
| VI.1.6 Erika F. | 147 | ||
| VI.1.7 Walther und Martha E. | 148 | ||
| VI.1.8 Margit B. | 149 | ||
| VI.1.9 Fazit | 151 | ||
| VI.1.10 Heimat und Sprache: ein Exkurs | 152 | ||
| VI.2 Die hebräische Sprache | 155 | ||
| VI.2.1 Lucca G. | 157 | ||
| VI.2.2 Margit B., Sylvia M. und Rita P. | 159 | ||
| VI.2.3 Erika F. | 160 | ||
| VI.2.4 Ernie S. | 161 | ||
| VI.2.5 Iulku K. | 162 | ||
| VI.2.6 Walther und Martha E. | 163 | ||
| VI.2.7 Fazit | 163 | ||
| VI.3 Die jiddische Sprache | 167 | ||
| VI.3.1 Die Beziehung der Interviewten zum Jiddischen | 169 | ||
| VI.3.2 Fazit | 174 | ||
| VI.4 Die rumänische Sprache | 178 | ||
| VII Spracherwerb und Sprachreflexion | 185 | ||
| VII.1 Angewandte Spracherwerbsstrategien | 186 | ||
| VII.2 Die Bewertung der Vielsprachigkeit im Rückblick | 191 | ||
| VII.3 Fazit | 193 | ||
| VIII Resümee | 193 |


 Powered by CloudPublish
Powered by CloudPublish